
Staat und Kirche, kontroverse Beziehung rund um die Kirchensteuer
Die Beziehung zwischen Staat und Kirche ist in Deutschland historisch tief verwurzelt, aber gleichzeitig auch hochgradig umstritten. Insbesondere die Kirchensteuer wirft immer wieder Fragen auf: Warum zahlen Bürgerinnen und Bürger eine Steuer für eine religiöse Institution? Wie werden die Gelder verwendet, und ist diese Praxis in einer zunehmend säkularen Gesellschaft noch zeitgemäß? Der folgende Beitrag beleuchtet die Geschichte, Funktionsweise und Kritikpunkte der Kirchensteuer und untersucht, wie die katholische Kirche mit diesen Mitteln umgeht.
Die Geschichte der Kirchensteuer in Deutschland
Die Kirchensteuer hat ihre Wurzeln im 19. Jahrhundert und entstand in einer Zeit, in der Staat und Kirche nach einer Phase der Säkularisierung wieder stärker miteinander verflochten wurden. Mit der Säkularisation zu Beginn des 19. Jahrhunderts enteigneten deutsche Fürstentümer große Teile des kirchlichen Besitzes. Um die Kirche für den Verlust dieser Einnahmequellen zu entschädigen, wurde die Kirchensteuer als Ersatz eingeführt.
Die gesetzliche Grundlage für die Kirchensteuer bildet der Artikel 140 des Grundgesetzes, der auf Artikel 137 der Weimarer Reichsverfassung verweist. Darin wird den Religionsgemeinschaften das Recht zugesprochen, von ihren Mitgliedern Steuern zu erheben. Gleichzeitig ist die Kirchensteuer nicht alleinige Sache der Kirche, sondern wird in Deutschland von den Finanzämtern des Staates eingezogen, die dafür eine Verwaltungsgebühr erhalten.
Der Zweck der Kirchensteuer
Die Kirchensteuer dient der Finanzierung der Kirchen und ihrer Aufgaben. Dazu gehören unter anderem:
- Unterhalt von Kirchengebäuden
- Bezahlung von Gehältern für Priester, Pfarrer und Kirchenangestellte
- Bildungs- und Sozialeinrichtungen, wie Schulen, Krankenhäuser und Altenheime
- Missionarische und karitative Projekte
Wie hoch ist die Kirchensteuer, und wer zahlt sie?
Die Kirchensteuer beträgt in den meisten Bundesländern 9 % der Lohn- oder Einkommensteuer (8 % in Bayern und Baden-Württemberg). Sie wird automatisch von den Finanzämtern eingezogen, sofern der Steuerpflichtige Mitglied einer kirchensteuerpflichtigen Religionsgemeinschaft ist, etwa der katholischen oder evangelischen Kirche.
Zahlen und Fakten zur Kirchensteuer:
- Einnahmen: Im Jahr 2022 beliefen sich die Kirchensteuereinnahmen auf rund 13 Milliarden Euro (katholische und evangelische Kirche zusammen).
- Mitgliederzahlen: Etwa 40 % der Deutschen sind Kirchenmitglieder, doch die Zahl der Austritte steigt stetig.
- Verwaltungsgebühren: Der Staat erhält für das Einziehen der Kirchensteuer eine Verwaltungsgebühr von etwa 3–4 % der Gesamteinnahmen.
Verwendung der Kirchensteuer: Wie transparent ist die Kirche?
Die katholische Kirche erklärt, dass die Kirchensteuer vor allem für pastorale und soziale Aufgaben verwendet wird. Doch in der Praxis ist die Verwendung der Mittel oft intransparent und wird nicht einheitlich offengelegt. Kritiker werfen der katholischen Kirche vor, dass ein erheblicher Teil der Kirchensteuer nicht direkt in gemeinnützige Projekte fließt, sondern in die Verwaltung und den Erhalt von kirchlichem Besitz, wie Bischofsresidenzen oder Verwaltungsgebäude.
Problematische Punkte:
- Luxusausgaben: Fälle wie der Bau der Bischofsresidenz in Limburg, der über 30 Millionen Euro kostete, haben das Vertrauen in die Verwendung der Kirchensteuer erheblich beschädigt.
- Intransparenz: Viele Diözesen veröffentlichen keine detaillierten Haushaltspläne, sodass unklar bleibt, wie die Mittel verwendet werden.
- Kritik an Hierarchieausgaben: Ein erheblicher Teil der Gelder fließt in die Gehälter hochrangiger Kirchenvertreter, während soziale Projekte oft von zusätzlichen Spenden oder Drittmitteln abhängen.
Kirchensteuer und Staatsleistungen: Eine doppelte Belastung?

Neben der Kirchensteuer erhalten die Kirchen in Deutschland auch direkte Staatsleistungen. Diese Zahlungen basieren auf Verträgen, die teils auf das 19. Jahrhundert zurückgehen, und dienen offiziell als Entschädigung für die Enteignungen während der Säkularisation.
Fakten zu den Staatsleistungen:
- Jährlicher Betrag: Etwa 500 Millionen Euro zahlen Bund und Länder jährlich an die Kirchen.
- Rechtsgrundlage: Diese Zahlungen sind in den Konkordaten (Verträgen zwischen Kirche und Staat) geregelt.
- Unbefristet: Trotz mehrfacher Forderungen nach einer Ablösung dieser Zahlungen wurden bisher keine konkreten Schritte unternommen.
Kritiker sehen die Staatsleistungen als doppelte Belastung der Steuerzahler, da die Kirchen bereits über die Kirchensteuer finanziert werden. Zudem wird infrage gestellt, warum diese Entschädigungen über 200 Jahre nach den Enteignungen noch immer gezahlt werden.
Kritik an der Kirchensteuer
1. Säkularisierung und Mitgliederschwund
Die Gesellschaft wird zunehmend säkular, und immer mehr Menschen treten aus der Kirche aus. Allein im Jahr 2021 verzeichneten die katholische und evangelische Kirche zusammen über 500.000 Austritte. Viele fragen sich, ob die Kirchensteuer in einer modernen, pluralistischen Gesellschaft noch zeitgemäß ist.
2. Ungerechte Belastung
Die Kirchensteuer ist an die Lohn- oder Einkommensteuer gekoppelt und trifft daher vor allem die Mittelschicht. Wohlhabendere Bürger mit weniger versteuerbarem Einkommen zahlen anteilig weniger.
3. Zwangsmechanismus
Die automatische Erhebung der Kirchensteuer durch den Staat wird als Eingriff in die Freiheit des Einzelnen kritisiert. Viele Menschen fühlen sich gezwungen, die Steuer zu zahlen, um ihre Kirchenzugehörigkeit nicht zu verlieren – etwa, weil sie kirchliche Dienstleistungen wie eine Hochzeit oder Beerdigung wünschen.
4. Kirchenaustritte und Konsequenzen
Der Austritt aus der Kirche ist oft mit persönlichen und gesellschaftlichen Konsequenzen verbunden. Menschen, die aus finanziellen Gründen austreten, werden in einigen Fällen von kirchlichen Aktivitäten ausgeschlossen, obwohl sie spirituell verbunden bleiben möchten.
Ist die Kirchensteuer noch zeitgemäß?
Die Frage nach der Zeitgemäßheit der Kirchensteuer spiegelt eine größere Debatte über die Rolle der Kirche in der Gesellschaft wider. Befürworter argumentieren, dass die Kirchensteuer eine stabile Finanzierung von wichtigen sozialen und karitativen Aufgaben ermöglicht. Kritiker hingegen fordern eine grundlegende Reform.
Reformvorschläge:
- Freiwillige Beiträge: Anstelle einer verpflichtenden Kirchensteuer könnten Mitglieder freiwillige Beiträge zahlen.
- Trennung von Staat und Kirche: Eine klare Trennung würde bedeuten, dass der Staat nicht mehr für die Einziehung der Kirchensteuer verantwortlich ist.
- Transparenzpflicht: Die Kirchen könnten verpflichtet werden, ihre Finanzen vollständig offenzulegen, um das Vertrauen der Gläubigen zurückzugewinnen.
Zwischen Tradition und Modernisierung
Die Kirchensteuer ist ein Relikt aus einer Zeit, in der Kirche und Staat enger verbunden waren. In einer zunehmend säkularen Gesellschaft wird diese Verbindung immer stärker infrage gestellt. Die katholische Kirche steht dabei besonders in der Kritik, da viele Menschen Transparenz und zeitgemäße Strukturen vermissen.
Es bleibt zu klären, ob die Kirchensteuer in ihrer jetzigen Form fortgeführt werden kann, oder ob ein Systemwechsel nötig ist. Die Frage, warum der Staat weiterhin Milliarden an die Kirche zahlt, verdient eine offene und kritische Diskussion. Denn in einer modernen Gesellschaft sollte die Unterstützung von Glaubensgemeinschaften freiwillig sein – getragen von den Überzeugungen und der Liebe der Gläubigen, nicht durch staatliche Mechanismen erzwungen.
25.09.2024
Uwe Taschow
Uwe Taschow
Als Autor denke ich über das Leben nach. Eigene Geschichten sagen mir wer ich bin, aber auch wer ich sein kann. Ich ringe dem Leben Erkenntnisse ab um zu gestalten, Wahrheiten zu erkennen für die es sich lohnt zu schreiben.
Das ist einer der Gründe warum ich als Mitherausgeber des online Magazins Spirit Online arbeite.
“Mehr als die Vergangenheit interessiert mich die Zukunft, denn in ihr gedenke ich zu leben.”
Albert Einstein


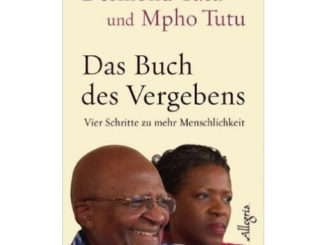



Hinterlasse jetzt einen Kommentar