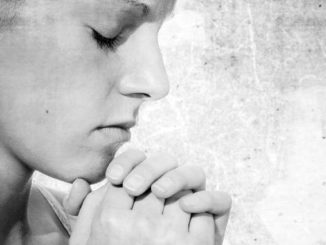Religion als Konstruktion: Gottesbeweise und ihre Konzepte
Religion und Religionssysteme
Der nachfolgende Beitrag untersucht interdisziplinär das Verhältnis von Mensch und Transzendenz. Dabei werden kulturhistorische, empirisch-neurobiologische und philosophisch-theologische Ansätze herangezogen, um die Konstruktion religiöser Systeme, die psychosoziale Funktion religiöser Erfahrungen sowie die epistemologischen Grundlagen klassischer Gottesbeweise zu analysieren. Religion lässt sich als das Verhältnis des Menschen zum Heiligen beziehungsweise zu einer transzendenten Wirklichkeit verstehen, wobei die bloße Religiosität keinen Beleg für das objektive Vorhandensein eines höheren Wesens darstellt. Die überlieferten Schöpfungsnarrative besitzen den Charakter von Mythen, die frühere Vorstellungen der Weltentstehung zu vermitteln suchten, und belegen, dass die komplexen Religionssysteme letztlich menschliche Erfindungen sind, deren kulturspezifische Ausprägungen den jeweiligen sozialen und historischen Kontext widerspiegeln. Die Entstehung religiöser Normen wird zudem durch grundlegende, unbewusste Nachahmungsprozesse erklärt, die als mimetische Mechanismen einen zentralen Steuerungsfaktor menschlichen Verhaltens darstellen. Bereits vor dem bewusst intendierten Imitieren wirken diese Prozesse als Katalysator für die Herausbildung normativ kodifizierter Handlungsanweisungen, die sich über Generationen hinweg als altruistische Verhaltensstandards manifestieren.
Ein höheres Wesen?
In Fällen, in denen die tatsächliche Ursache im eigentlichen empirischen Sinne unzugänglich bleibt, erscheint die Zuschreibung an ein höheres Wesen als logische Alternative. Dieses Phänomen, das in rituellen Handlungen wie dem Gebet eine selbstverstärkende Wirkung entfaltet, führt dazu, dass als funktional erprobte Verhaltensweisen projektionell als göttliche Gebote deklariert und in den kollektiven Erfahrungsschatz einer Gemeinschaft integriert werden. Auf diese Weise etabliert sich ein normativer Rahmen, der nicht nur das individuelle, sondern vor allem das soziale Zusammenleben reguliert, indem er über Generationen hinweg zu einem stabilisierenden Faktor kultiviert wird.
Das Konstrukt des Göttlichen
Das Konstrukt des Göttlichen wirkt in religiösen Systemen unabhängig von dessen empirischer Bestimmbarkeit. Es dient als methodische Abkürzung, um komplexe, oftmals unerklärliche Phänomene zu deuten und zugleich als Instrument, um innerhalb bestimmter Gruppierungen Macht auszuüben. Rituelle Kontexte und ideologische Instrumente ermöglichen es, das Symbol des Göttlichen gezielt zur Steuerung und Bindung von Gemeinschaften zu nutzen, wobei sowohl sichtbare als auch unsichtbare Mechanismen zum Tragen kommen. Parallel dazu führte der wissenschaftliche Paradigmenwechsel im 19. Jahrhundert zu einem fundamentalen Hinterfragen der als selbstverständlich erachteten Ordnung der Welt, was letztlich den Diskurs über gesellschaftliche Normen und kollektive Wertvorstellungen neu belebte.
Seelisches Wohlbefinden und psychosoziale Entlastung

Religiöse Erfahrungen gehen mit spezifischen neuronalen Aktivitäten einher, wobei das Gehirn von Natur aus danach strebt, Ursachen für auftretende Phänomene zu identifizieren. Neurowissenschaftliche Untersuchungen haben gezeigt, dass als religiös empfundene Erfahrungen häufig mit kleinen neuronalen Entladungsereignissen im Temporallappen korrelieren, die euphorische Zustände und eine Reduktion existenzieller Ängste bewirken können. Verschiedene Auslöser – wie emotionaler Stress, der Verlust nahestehender Menschen, der Einfluss psychoaktiver Substanzen oder auch künstlerische Reize – beschleunigen den Eintritt solcher Zustände. Andere neurobiologische Ansätze fassen mystische Versenkungserlebnisse als Phänomene zusammen, in denen die Grenze zwischen dem Selbst und der Außenwelt zu verschwimmen beginnt, was in einem Gefühl der universellen Einheit und dem Auflösen klassischer Raum-Zeit-Bezüge mündet. Empirische Befunde deuten darauf hin, dass die aktive Teilnahme am gemeinschaftlichen Religionsleben sowie das regelmäßige Ausüben ritueller Praktiken, beispielsweise das Eingestehen von Schuld und die damit verbundene Vergebungszusage, signifikant zur Stärkung des seelischen Wohlbefindens beitragen. Die psychosoziale Entlastung, die durch die Wiederherstellung von Verantwortungsgefühl, Würde und Selbstwert erfolgt, bietet gerade in Krisenzeiten einen stabilisierenden Rahmen. Die unmittelbare Konfrontation mit der eigenen Endlichkeit veranlasst den Menschen, symbolische, kulturelle oder transzendente Wege zu suchen, die als bewusster Akt des Glaubens Trost spenden – auch wenn hierfür empirisch fundierte Belege fehlen. Cormac McCarthy lässt seinen „Propheten“ Elija hierzu folgerichtig formulieren: „Es gibt keinen Gott – und wir sind seine Propheten.“
Fortbestand der Seele oder finales Funktionsversagen?
Im Gegensatz zu den religiösen Systemen, die auf überlieferten Texten und subjektiven Erfahrungswelten beruhen, basiert die empirische Methode auf quantitativen Messungen, systematischen Beobachtungen und der ständigen Überprüfung und Anpassung von Hypothesen. Dieser Ansatz führt zu einer kontinuierlichen Revision theoretischer Modelle, während religiöse Deutungen den Fortbestand der Seele in einer transzendenten Dimension postulieren, ohne einer experimentellen Überprüfung zu unterliegen. Wissenschaftliche Diskurse definieren den Tod als den endgültigen Ausfall biologischer und neuronaler Funktionen, wohingegen religiöse Interpretationen den physischen Tod als Übergang in einen jenseitigen Zustand begreifen. Beide Zugänge – der methodisch-kritische Ansatz der Naturwissenschaft und das normative Fundament religiöser Überlieferungen – repräsentieren unterschiedliche epistemologische Perspektiven, die versuchen, das Phänomen Leben und Sterben zu erklären. Während sich die Wissenschaft durch permanenten Zweifel und die Anpassung an neue, reproduzierbare Daten auszeichnet, bieten religiöse Systeme in Zeiten existenzieller Krisen stabile, symbolisch aufgeladene Orientierungsrahmen, die psychische und soziale Kontinuität fördern. Interdisziplinäre Ansätze verbinden hierbei Erkenntnisse aus Naturwissenschaft, Philosophie und Theologie, um die Vielschichtigkeit menschlicher Existenz umfassend zu begreifen. Während naturwissenschaftliche Modelle materielle Prozesse und physikalische Gesetzmäßigkeiten detailliert erklären, beleuchten philosophische und theologische Betrachtungen das subjektive Erleben von Sinn, Transzendenz und Unsterblichkeit. Kulturelle und künstlerische Ausdrucksformen ergänzen diese Perspektiven, indem sie emotionale Dimensionen symbolisch veranschaulichen. Die Synthese aus empirischer Strenge und transzendenter Deutung eröffnet ein erweitertes Gesamtverständnis der Realität, indem quantitative Daten und symbolisch erfahrene Glaubensinhalte in einen integrativen Diskurs einfließen. Die Verbindung beider Perspektiven – des methodischen Zweifels der Wissenschaft und der stabilisierenden Orientierung religiöser Traditionen – generiert neue Ansätze zur Erklärung existenzieller Fragen. Dadurch wird ein interdisziplinärer Dialog befördert, der den vielfältigen Anforderungen menschlicher Existenz gerecht wird und die komplexe Beziehung zwischen Mensch und dem Göttlichen in ihrer ganzen Vielschichtigkeit erhellt.
Der Mensch auf der Suche nach dem Sinn
Evolutionstheoretische Betrachtungen verdeutlichen, dass der Fortbestand einer Art primär durch die Weitergabe von Genen gesichert wird, während das individuelle Überleben eine untergeordnete Rolle spielt. Dieses biologische Grundprinzip steht jedoch im Kontrast zum menschlichen Streben, dem eigenen Dasein eine tiefgreifende, symbolische Bedeutung und einen Daseinszweck zu verleihen – ein Bestreben, das sich in kulturellen, künstlerischen und religiösen Leistungen manifestiert. Die Suche nach Gottesbeweisen ist daher eng gekoppelt mit der Suche nach dem Sinn. Die Frage nach dem Sinn des Lebens, also dem Sinn der inneren und äußeren Existenz, ist laut Viktor Frankl eine Kernfrage und primäre Motivation, die den Menschen erst zum Menschen macht. Ihre Nichtbeantwortung begünstigt depressive und neurotische Erkrankungen, weil es ein starkes Spannungsfeld zwischen Sinnsuche und Lebensrealität gibt (die sog. Kollision von Erwartung und Erfahrung). Menschen, die über „innere Leere“ klagen und ohne feste Persönlichkeitsstruktur sind, sind psychiatrischen Beobachtungen zufolge überwiegend konfessionslos. Sinnsuche und Sinnfindung sind häufig verknüpft mit folgenden Fragen:
- Worin besteht mein Daseinszweck (Sinn des Lebens)?
- Wie will ich leben, um meinen Daseinszweck zu erfüllen (wertebasierter Lebensweg)?
Ob etwas sinnvoll und wertvoll für uns ist, wird jedoch stark individuell empfunden und hängt davon ab, welche Maßstäbe und Werte wir unserer gegenwärtigen Sinnsuche zugrunde legen (Selbstwahrnehmung). Sinnvoll erscheint uns unser Leben immer dann, wenn es unserer idealen Wertvorstellung entspricht. Der Sinnmaßstab, die Sinngebung oder die Frage, was sinnstiftend ist, ist dabei durchaus dem Zeitgeist einer Generation, Epoche und Kultur unterworfen, d.h., dass jede Generation, jede Epoche und jede Kultur ihre eigenen Maßstäbe und Einflüsse für Sinn hat (d.h., was wird vom Einzelnen und von der Allgemeinheit als sinnvoll erachtet? Was ist der ethische Stellenwert?). Die Diskussion um sinnstiftende Gottesbeweise gehört insofern zu den zentralen Fragen philosophischer und theologischer Reflexion. Seit Jahrhunderten versucht die Menschheit, die Existenz eines höchsten Wesens rein durch Vernunft und Beobachtung der natürlichen Ordnung zu belegen. Unterschiedliche Ansätze wurden hieraus entwickelt, um die jeweils verschiedenen Aspekte des Göttlichen zu beleuchten. Abschließend werden einige prominente Versuche zur Beweisführung der Existenz Gottes kurz skizziert:
Gottesbeweise und ihre Konzepte – Gott als erste, unbewirkte Ursache

Thomas von Aquins Gottesbeweis beruht auf der grundlegenden Annahme, dass alles, was existiert, eine Ursache haben muss. Er stützt sich auf das Prinzip der Kausalität, welches besagt, dass jede Wirkung eine Ursache hat, und schließt daraus, dass eine unendliche Kausalkette nicht möglich sein kann, da sie zu einem logischen Widerspruch führen würde. Daher postuliert Thomas von Aquin, dass es eine erste, unbewirkte Ursache geben muss, die selbst nicht durch etwas anderes verursacht wurde. Diese Ursprungshypothese legt nahe, dass Gott diese absolute, erste Ursache ist. Der Gottesbeweis Thomas’ basiert auf drei zentralen Grundannahmen. Erstens ist das Prinzip der Kausalität sowie die Notwendigkeit einer ersten Ursache uneingeschränkt zulässig. Zweitens muss alles, was existiert, eine Ursache haben, da aus dem Nichts nichts entstehen kann. Drittens folgt zwangsläufig, dass es eine erste Ursache geben muss, die selbst unbewirkt ist. Diese unbewirkte Ursache bildet somit die Grundlage allen Seins und verweist auf einen Ursprung, der jenseits der natürlichen Ordnung liegt.
Grundannahme:
- a) Das Prinzip der Kausalität und der Notwendigkeit einer ersten Ursache ist zulässig
- b) Alles, was existiert, muss eine Ursache haben
- c) Es muss eine erste Ursache geben, die selbst unbewirkt ist – und das ist Gott, der unbewegte Beweger.
Gott als intelligenter Designer der Komplexität und Ordnung im Universum
Das Argument des Designs ist ein Gottesbeweis, der die Komplexität und Ordnung des Universums in den Mittelpunkt stellt. Die Grundannahme dieses Arguments lautet, dass in der Natur ein erkennbarer Grad an Systematik und Präzision existiert, der nicht allein dem Zufall zugeschrieben werden kann. Vielmehr wird daraus geschlossen, dass ein intelligenter Designer hinter der Schöpfung steht. Die beeindruckende Vielfalt der Lebensformen, das harmonische Zusammenspiel der Naturgesetze und die feine Abstimmung kosmischer Prozesse deuten darauf hin, dass das Universum das Werk eines höheren Wesens ist. In diesem Zusammenhang wird Gott als intelligenter Designer betrachtet, der die Komplexität und Ordnung im Kosmos inszeniert hat. Im 18. Jahrhundert erlangte die Theorie zusätzliche Aufmerksamkeit durch William Paley, der mit seiner berühmten Uhrmacheranalogie verdeutlichte, dass aus der Komplexität einer Uhr ebenso auf einen Uhrmacher geschlossen werden kann wie aus der Komplexität des Universums auf einen intelligenten Designer. So wie eine Uhr ohne einen Uhrmacher nicht existieren kann, erscheint es unwahrscheinlich, dass das Universum und seine präzise abgestimmten Prozesse zufällig entstanden sind.
Grundannahme:
- a) Komplexität und Ordnung im Universum
- b) Hinweis auf einen intelligenten Designer
Gott als Schöpfer moralischer Werte und höchster moralischer Gesetzgeber
Immanuel Kants moralischer Gottesbeweis stützt sich auf die Annahme, dass objektive moralische Werte und Pflichten unabhängig von individuellen Neigungen existieren und somit einem höchsten moralischen Gesetzgeber zugeordnet werden müssen. Kant argumentiert, dass diese unveränderlichen ethischen Prinzipien nicht willkürlich entstanden sein können, sondern aus einer transzendenten Quelle mündeten, die als Gott verstanden wird. Dabei wird Gott zum Schöpfer und Bewahrer aller moralischen Ordnungen, indem er objektive Maßstäbe wie Gerechtigkeit, Pflichtbewusstsein und Verantwortlichkeit festlegt. Ohne einen solchen höchsten moralischen Gesetzgeber bliebe die Grundlage unseres ethischen Handelns beliebig und relativ, was das Streben nach universeller Wahrheit und moralischer Integrität untergraben würde. Die Grundannahme, dass objektive moralische Werte existieren, erfordert demnach die Existenz eines Wesens, das diese Werte ins Dasein gerufen und verankert hat. In Kants Sichtweise ist Gott somit nicht nur eine metaphysische Entität, sondern der Garant für die absolute und überzeitliche Gültigkeit moralischer Normen, der das Handeln des Menschen auf einen festen, unverrückbaren ethischen Rahmen stellt.
Grundannahme:
- a) Es existieren objektive moralische Werte und Pflichten
- b) Das setzt die Existenz eines höchsten moralischen Gesetzgebers voraus (Gott)
Gott als größte denkbare Existenz
Der Beweis, der besagt, dass Gott als das größte denkbare Wesen notwendigerweise in der Realität existieren muss, ist als ontologischer Gottesbeweis bekannt. Diese Argumentationslinie wurde ursprünglich von Anselm von Canterbury im 11. Jahrhundert formuliert. Nach diesem Argument muss Gott, als das größte denkbare Wesen, in der Realität existieren. Dies impliziert, dass Gott, als das größte denkbare Wesen, in der Realität existieren muss, weil es größer ist, in der Realität zu existieren, als nur in der Vorstellung. Die Grundannahme lautet: Ein Wesen, das sowohl gedacht als auch real existiert, besitzt eine höhere Vollkommenheit als ein rein gedachtes Konzept. Wäre Gott lediglich ein Vorstellungsbild, so ließe sich ein noch überlegenes Wesen konzipieren, dessen Existenz nicht nur im Geist, sondern auch in der Wirklichkeit verankert ist. Dieser Schluss führt zu einem logischen Widerspruch, da niemand das absolute Maximum in Frage stellen darf. Existenz in der Realität gilt als wesentlich größer, weil sie einer Idee Substanz und Präsenz verleiht. Dadurch wird Gott zu einem Wesen, das nicht nur als abstrakte Idee, sondern als tatsächliche Wirklichkeit definiert wird. Letztendlich unterstreicht dieses Argument die Unvereinbarkeit eines Gottes, der ausschließlich im Verstand existiert, mit dem Konzept des größten denkbaren Wesens. Der Gottesbeweis verdeutlicht, wie eng Vorstellungskraft und reale Existenz miteinander verknüpft sind, um das Prinzip der Vollkommenheit abschließend zu stützen.
Grundannahme:
- a) Ein Wesen, das sowohl in der Vorstellung als auch in der Realität existiert, ist größer als ein Wesen, das nur in der Vorstellung existiert.
- b) Wenn Gott nur in der Vorstellung existiert, dann könnte man sich ein größeres Wesen vorstellen, das auch in der Realität existiert.
- c) Dies wäre ein Widerspruch, da Gott das größte denkbare Wesen sein soll.
- d) Daher muss Gott in der Realität existieren.
Gott als Ereignis mit Nicht-Null-Wahrscheinlichkeit
In einem Universum, das in der Zeit unbegrenzt ist, folgt aus der Unendlichkeit der zeitlichen Ausdehnung, dass alle denkbaren Ereignisse und Zustände letztlich eintreten werden. Selbst das extrem unwahrscheinliche Ereignis der Existenz eines ewigen Wesens darf in einem solchen Universum nicht ausgeschlossen werden, da in einem unendlichen Zeitrahmen jede Möglichkeit mit einer Wahrscheinlichkeit größer als null realisiert wird. Dieser Gottesbeweis stützt sich auf vier Grundannahmen: Erstens, dass alle möglichen Ereignisse in einer unendlichen Zeit ihren Eintritt finden. Zweitens, dass das Universum in der Zeit unendlich ist. Drittens, dass alle Ereignisse gleich wahrscheinlich sind. Viertens, dass die Anwendung von Wahrscheinlichkeitsbegriffen auf metaphysische Konzepte zulässig ist. Unter Berücksichtigung dieser Annahmen erscheint es logisch, dass die Existenz eines ewigen Wesens (Gott) als Folge der Unendlichkeit unausweichlich werden muss.
Grundannahme:
- a) Alle möglichen Ereignisse treten in einer unendlichen Zeit ein
- b) Das Universum ist unendlich in der Zeit
- c) Alle Ereignisse sind gleich wahrscheinlich
- d) Die Anwendung der Wahrscheinlichkeit auf metaphysische Konzepte ist zulässig
Dieser Beitrag ist Teil des thematischen Schwerpunkts Spirituelles Bewusstsein auf Spirit Online. Dort findest du weiterführende Artikel, Perspektiven und Orientierung zur bewussten Entwicklung von Geist, Wahrnehmung und innerer Haltung. → Spirituelles Bewusstsein
23.05.2025
Claus Eckermann
Sprachwissenschaftler und HypnosystemCoach®
Kurzvita
HSC Claus Eckermann FRSA
Claus Eckermann ist ein deutscher Sprachwissenschaftler und HypnosystemCoach®, der u.a. am Departements Sprach- und Literaturwissenschaften der Philosophisch-Historischen Fakultät der Universität Basel und der Theodor-Heuss-Akademie der Friedrich-Naumann-Stiftung unterrichtet hat.
Er ist spezialisiert auf die Analyse von Sprache, Körpersprache, nonverbaler Kommunikation und Emotionen. Indexierte Publikationen in den Katalogen der Universitäten Princeton, Stanford, Harvard und Berkeley.