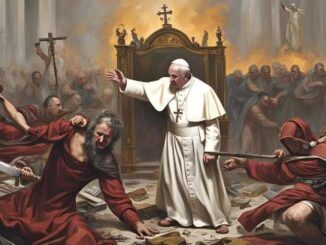Spiritualität und das Schweigen der Intellektuellen
In den vergangenen Jahren sind die großen Systeme unserer Gesellschaft ins Wanken geraten: demokratische Institutionen, wissenschaftliche Autoritäten, Medienlandschaften, Bildungsräume. Orientierung wird zur Mangelware, Vertrauen zur fragilen Größe. Doch was auffällt: Inmitten dieser globalen Verunsicherung sind es nicht nur Politiker oder Journalisten, die verstummen oder verflachen – sondern ausgerechnet diejenigen, von denen man Tiefgang, Differenzierung und moralische Haltung erwarten würde: die Intellektuellen.
Gleichzeitig wächst die spirituelle Leerstelle im öffentlichen Diskurs. Zwischen Faktenhuberei, Meinungsschlachten und moralischen Kurzschlüssen bleibt oft keine Luft mehr für die großen Fragen: Was ist ein Mensch? Was bedeutet Würde? Was ist das Gute? Spiritualität, einst Quelle kultureller Kraft, wird heute entweder ins Private gedrängt oder dem Markt geopfert. Das Ergebnis: eine sprach- und geistlose Öffentlichkeit mit hoher Informationsdichte, aber geringer Bedeutungstiefe.
Warum also schweigen Intellektuelle, wenn spirituelle Orientierung fehlt?
Und was bedeutet dieses Schweigen für eine Gesellschaft, die immer mehr in Unverbundenheit, Sinnverlust und Reizüberflutung versinkt?
I. Intellektuelle Verantwortung im Umbruch der Welt
Traditionell galten Intellektuelle als moralische Instanz einer Gesellschaft. Menschen wie Albert Camus, Simone Weil, Hannah Arendt oder später Jürgen Habermas standen für ein Denken, das sich einmischte – nicht parteipolitisch, sondern ethisch. Ihre Stimme war unbequem, aber notwendig. Intellektuelle waren Wächter der Menschlichkeit.
Heute wirkt dieses Bild brüchig. Während sich Krisen überlagern – Klima, Krieg, Pandemie, Demokratiekrise, digitale Entfremdung – ist die intellektuelle Stimme häufig abwesend oder angepasst. Viele ziehen sich auf wissenschaftlich abgesicherte Positionen zurück, meiden metaphysische Fragen, vermeiden klare Haltungen – aus Angst vor Emotionalisierung oder Vereinnahmung.
Doch: Gerade in Zeiten der Umbrüche reicht Analyse nicht mehr aus.
Es braucht Orientierung – nicht im Sinne fertiger Antworten, sondern als geistige Tiefenschärfe, die ethisch trägt.
II. Spiritualität als blinder Fleck der Intellektuellen
Warum aber bleibt ausgerechnet das Thema Spiritualität in intellektuellen Debatten so unterbelichtet?
1. Historische Erbschaft: Rationalismus vs. Innerlichkeit
Die Aufklärung, das große Projekt der Vernunft, trennte klar zwischen Wissen und Glauben. Religion galt als Privatsache, Spiritualität als irrational oder naiv. Diese Spaltung wirkt bis heute nach. Der Intellektuelle darf vieles – aber „glauben“ darf er nicht. Er darf fühlen – aber nicht beten. Er darf zweifeln – aber nicht sich hingeben.
Dabei zeigen die Krisen der Gegenwart: Reine Rationalität reicht nicht aus, um eine erschütterte Gesellschaft zu heilen. Was fehlt, ist eine Form von verbundener Erkenntnis, in der Geist, Herz und Haltung zusammenkommen.
2. Akademische Selbstzensur
Die akademische Welt meidet spirituelle Themen häufig aus Angst, unseriös zu wirken. Begriffe wie „Bewusstsein“, „Transzendenz“ oder gar „Seele“ gelten als unwissenschaftlich – obwohl gerade die Quantenphysik, die Tiefenpsychologie oder die Neurophilosophie längst an Grenzen stoßen, die spirituelle Fragen unausweichlich machen.
Wie Rupert Sheldrake in seinem Buch Der Wissenschaftswahn schreibt:
„Wissenschaft hat sich selbst ein Gefängnis gebaut, indem sie nur das als real anerkennt, was messbar ist.“
(Quelle: Rupert Sheldrake, „Der Wissenschaftswahn“, 2012)
3. Politische Instrumentalisierung des Religiösen
Religion wird heute häufig mit Fanatismus, Fundamentalismus oder Missbrauch in Verbindung gebracht. Das erzeugt bei Intellektuellen Misstrauen. Doch Spiritualität ist nicht Religion im engeren Sinne. Sie ist keine Dogmatik, sondern eine Dimension der Tiefe – ein Raum innerer Erfahrung, der mit Ethik, Sinn und Verbindung zu tun hat.
III. Das spirituelle Defizit der Gegenwart
Die Symptome eines kollektiven Sinnverlusts sind überall sichtbar:
-
Psychische Erkrankungen nehmen zu – vor allem Depression, Angst und Burnout.
-
Soziale Spaltung verschärft sich, da Empathie schwindet.
-
Politischer Extremismus wächst – gespeist aus Leere, Ohnmacht und dem Wunsch nach Zugehörigkeit.
-
Kulturelle Verflachung breitet sich aus – Aufmerksamkeit wird zur Währung, Tiefe zum Risiko.
Ohne spirituelles Fundament wird Gesellschaft technokratisch, konsumistisch oder zynisch. Das Menschliche verkommt zur Option – nicht mehr zur Grundlage.
IV. Die neue Aufgabe der Intellektuellen: Klarheit mit Seele
Was wäre, wenn Intellektuelle die spirituelle Leerstelle nicht meiden, sondern gestalten würden? Wenn sie sich nicht länger nur als Kommentatoren der Welt verstehen würden, sondern als Geburtshelfer für ein neues Bewusstsein?
Dazu braucht es vier Dinge:
-
Mut zur Transzendenz: Die Bereitschaft, sich dem zu öffnen, was über das rein Rationale hinausgeht – ohne sich irrational zu verlieren.
-
Ethik aus Tiefe: Eine Haltung, die nicht aus Ideologie kommt, sondern aus spiritueller Gewissensbildung.
-
Sprache mit Seele: Eine neue Sprache, die nicht nur erklärt, sondern verbindet – Logos und Mythos, Analyse und Poesie.
-
Präsenz statt Distanz: Die Bereitschaft, nicht nur über Gesellschaft zu sprechen, sondern in ihr anwesend zu sein – mit fühlendem Verstand.
V. Spiritualität als transformative Kraft – keine Wellnessoption

In einer Zeit, in der viele Menschen sich nach Orientierung sehnen, kann Spiritualität eine Brücke sein: zwischen Verstand und Gefühl, zwischen Analyse und Sinn, zwischen Krise und Heilung. Aber nur, wenn sie nicht zur Komfortzone verkommt.
Wie der französische Soziologe Edgar Morin sagte:
„Wir brauchen eine Spiritualität, die uns nicht betäubt, sondern wach macht.“
(Quelle: Edgar Morin, „Homöopathie des Geistes“, 2015)
Diese Spiritualität ist unbequem. Sie verlangt Eigenverantwortung, Stille, Tiefe. Sie geht über Identitätspolitik und Lifestyle hinaus. Und sie erfordert ein Denken, das bereit ist, sich selbst zu überschreiten.
VI. Literatur, die Brücken schlägt
Wer sich auf diese Ebene einlassen will, findet Wegmarken bei Autor:innen, die Denken und Spiritualität miteinander verbinden:
-
Simone Weil – Schwerkraft und Gnade (1947): Über Mystik und politisches Gewissen
-
Erich Fromm – Haben oder Sein (1976): Über die spirituelle Dimension des Humanismus
-
David Steindl-Rast – Achtsamkeit – Das Tor zur Lebendigkeit (2013): Über gelebte Spiritualität in einer säkularen Welt
-
Christina Kessler – Die Sehnsucht unserer Seele (2005): Eine integrale Ethik für die Zukunft
-
Thomas Hübl – Kollektives Trauma heilen (2021): Spirituelle Arbeit im gesellschaftlichen Feld
Diese Stimmen zeigen: Spiritualität und Intellekt sind keine Gegner. Sie sind unvollständig ohne einander.
Fazit: Eine Stimme wird fehlen, wenn sie fehlt
Das Schweigen der Intellektuellen zu spirituellen Fragen ist kein Zeichen von Neutralität. Es ist ein Verzicht – auf Tiefe, auf Ganzheit, auf Menschlichkeit. In einer Zeit, in der die Gesellschaft von innerer Entfremdung bedroht ist, braucht es neue geistige Integrität. Kein Rückfall in religiöse Autorität – aber ein Aufbruch zu spiritueller Verantwortung im Denken.
Wer schreibt, wer spricht, wer lehrt – trägt Verantwortung. Und diese Verantwortung reicht heute tiefer als je zuvor. Denn die Menschheit steht nicht nur vor politischen oder ökologischen Fragen. Sondern vor der Frage: Was macht uns eigentlich noch aus?
Weiterführende Links & Quellen:
-
Sheldrake, Rupert: Der Wissenschaftswahn. Arkana Verlag, 2012
-
Morin, Edgar: Homöopathie des Geistes. Suhrkamp, 2015
-
Weil, Simone: Schwerkraft und Gnade. Kösel, 1947
-
Kessler, Christina: Die Sehnsucht unserer Seele. Scherz Verlag, 2005
10.05.2025
Uwe Taschow
Uwe Taschow
Unser Leben ist das Produkt unserer Gedanken – eine Erkenntnis, die schon Marc Aurel, der römische Philosophenkaiser, vor fast 2000 Jahren formulierte. Und nein, sie ist nicht aus der Mode gekommen – im Gegenteil: Sie trifft heute härter denn je.
Denn all das Schöne, Hässliche, Wahre oder Verlogene, das uns begegnet, hat seinen Ursprung in unserem Denken. Unsere Gedanken sind die Strippenzieher hinter unseren Gefühlen, Handlungen und Lebenswegen – sie formen Helden, erschaffen Visionen oder führen uns in Abgründe aus Wut, Neid und Ignoranz.
Ich bin Autor, Journalist – und ja, auch kritischer Beobachter einer Welt, die sich oft in Phrasen, Oberflächlichkeiten und Wohlfühlblasen verliert. Ich schreibe, weil ich nicht anders kann. Weil mir das Denken zu wenig und das Schweigen zu viel ist.
Meine eigenen Geschichten zeigen mir nicht nur, wer ich bin – sondern auch, wer ich nicht sein will. Ich ringe dem Leben Erkenntnisse ab, weil ich glaube, dass es Wahrheiten gibt, die unbequem, aber notwendig sind. Und weil es Menschen braucht, die sie aufschreiben.
Deshalb schreibe ich. Und deshalb bin ich Mitherausgeber von Spirit Online – einem Magazin, das sich nicht scheut, tiefer zu bohren, zu hinterfragen, zu provozieren, wo andere nur harmonisieren wollen.
Ich schreibe nicht für Likes. Ich schreibe, weil Worte verändern können. Punkt.