
In einer Welt von Gut und Böse
Täglich erleben wir das Nachrichtenbombardement von grauenvollen Taten auf der Welt, oftmals in unmittelbarer Umgebung. Immer wieder stehen wir fassungslos vor dem, was Menschen für ein Unheil anrichten mit den Kräften ihrer seelischen Fantasien. Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass der Mensch den Dualismus von Gut und Böse schafft.
In einer Welt von Gut und Böse
„Ich bin ein Teil von jener Kraft,
die stets das Böse will und stets das Gute schafft“.
(Johann Wolfgang von Goethe, Faust Teil 1)
Jesus Christus spricht in seiner berühmten Bergpredigt, Matthäus-Evangelium 5,45: „Der Vater im Himmel lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte.“
Das heißt konkret: der große Kosmos unterscheidet und urteilt nicht, greift auch nicht in das menschliche Geschehen ein.
Als Verkörperung des Teufels liegt es in Goethes Faust in der Natur des Mephisto, stets das Böse zu wollen. Wie ist es dann möglich, dass er dennoch „stets das Gute schafft“? Als Inkarnation des Bösen ist Mephisto bloß dessen manifestierter Teil. Er arbeitet im Auftrag der Urkraft des Bösen, die selbst nicht in Erscheinung tritt, jedoch alle Erscheinungen des Bösen inszeniert. In seiner Unmittelbarkeit ist das Böse zunächst nur eine Idee, das heißt, der reine böse Wille. Um wirklich werden zu können, muss es sich seinem Gegenteil in der Welt stellen. So kommt es zum Kampf zwischen Gut und Böse.
Dadurch verhindert das Böse zwar die Existenz des Guten in seiner reinen Form, doch damit ist nicht wirklich etwas gewonnen. Im Gegenteil: In seiner reinen Form wäre das Gute nämlich – ebenso wie das Böse – eine bloße Idee ohne Wirklichkeit. Konsequent zu Ende gedacht bedeutet dies: Das Böse ist der Nährboden des Guten. Ohne die Kraft der Negativität könnte nichts Gutes wachsen.
Dadurch dass das Böse dem Guten in der Welt entgegentritt,
erreicht es also das Gegenteil dessen, was sein ursprünglicher Wille war. Es ermöglicht dem Guten überhaupt erst, in der Welt Fuß zu fassen. Aus der bloßen Idee des Guten wird das wirklich Gute somit durch die Intervention des Bösen. Das mag paradox klingen, ist aber nach dialektischem Verständnis vollkommen logisch. Mephisto verkörpert tatsächlich die Kraft, die – weil sie das Böse will – das Gute schafft.
Wer nicht gerade ein Mainstream-Denker ist, wird einräumen, dass das größte Unheil in der Menschheitsgeschichte von denen angerichtet wurde, die das absolut Gute auf ihre Fahnen geschrieben haben. Die gefährlichsten Verbrecher waren stets die, die davon überzeugt waren, das Gute zu verkörpern, besonders die, die glaubten, eine göttliche Mission zu erfüllen. Das Göttliche aber – und das ist eine weitere logische Konsequenz der Dialektik – muss jenseits von Gut und Böse sein.
Im FAUST Teil I hat Johann Wolfgang von Goethe sein Welt- und Menschenbild auf unterschiedlichsten Ebenen dargestellt. Er greift konventionelle Vorstellungen auf, um diese kritisch zu hinterfragen und sein eigenes Verständnis vom Wesen des Menschen und den Zuständen der Zeit zu konkretisieren.

Irren und Streben, Gut und Böse als zwei Bestandteile der göttlichen Ordnung
Im „Prolog im Himmel“ werden das Irren und Streben des Menschen thematisiert. Eingebunden ist dieser Komplex in das Thema der Religion und des spirituellen Glaubens. Hierbei werden die Religion als Instanz des gesellschaftlichen Lebens und die starre religiöse Einteilung in Gut und Böse infrage gestellt.
Raphael:
Die Sonne tönt, nach alter Weise,
In Brudersphären Wettgesang,
Und ihre vorgeschriebene Reise
Vollendet sie mit Donnergang.
Ihr Anblick gibt den Engeln Stärke,
Wenn keiner sie ergründen mag;
die unbegreiflich hohen Werke
Sind herrlich wie am ersten Tag.
Gabriel:
Und schnell und unbegreiflich schnelle
Dreht sich umher der Erde Pracht;
Es wechselt Paradieseshelle
Mit tiefer, schauervoller Nacht.
Es schäumt das Meer in breiten Flüssen
Am tiefen Grund der Felsen auf,
Und Fels und Meer wird fortgerissen
Im ewig schnellem Sphärenlauf.
Michael:
Und Stürme brausen um die Wette
Vom Meer aufs Land, vom Land aufs Meer,
und bilden wütend eine Kette
Der tiefsten Wirkung rings umher.
Da flammt ein blitzendes Verheeren
Dem Pfade vor des Donnerschlags.
Doch deine Boten, Herr, verehren
Das sanfte Wandeln deines Tags.
Mephistopheles:
Da du, o Herr, dich einmal wieder nahst
Und fragst, wie alles sich bei uns befinde,
Und du mich sonst gewöhnlich gerne sahst,
So siehst du mich auch unter dem Gesinde.
Verzeih, ich kann nicht hohe Worte machen,
Und wenn mich auch der ganze Kreis verhöhnt;
Mein Pathos brächte dich gewiß zum Lachen,
Hättst du dir nicht das Lachen abgewöhnt.
Von Sonn’ und Welten weiß ich nichts zu sagen,
Ich sehe nur, wie sich die Menschen plagen.
Der kleine Gott der Welt bleibt stets von gleichem Schlag,
Und ist so wunderlich als wie am ersten Tag.
Ein wenig besser würd er leben,
Hättst du ihm nicht den Schein des Himmelslichts gegeben;
Er nennt’s Vernunft und braucht’s allein,
Nur tierischer als jedes Tier zu sein.
Er scheint mir, mit Verlaub von euer Gnaden,
Wie eine der langbeinigen Zikaden,
Die immer fliegt und fliegend springt
Und gleich im Gras ihr altes Liedchen singt;
Und läg er nur noch immer in dem Grase!
In jeden Quark begräbt er seine Nase.
DER HERR:
Hast du mir weiter nichts zu sagen?
Kommst du nur immer anzuklagen?
Ist auf der Erde ewig dir nichts recht?
Mephistopheles:
Nein Herr! ich find es dort, wie immer, herzlich schlecht.
Die Menschen dauern mich in ihren Jammertagen,
Ich mag sogar die armen selbst nicht plagen.
DER HERR:
Kennst du den Faust?
Mephistopheles:
Den Doktor?
DER HERR:
Meinen Knecht!
Mephistopheles:
Fürwahr! er dient Euch auf besondre Weise.
Nicht irdisch ist des Toren Trank noch Speise.
Ihn treibt die Gärung in die Ferne,
Er ist sich seiner Tollheit halb bewußt;
Vom Himmel fordert er die schönsten Sterne
Und von der Erde jede höchste Lust,
Und alle Näh und alle Ferne
Befriedigt nicht die tiefbewegte Brust.
DER HERR:
Wenn er mir auch nur verworren dient,
So werd ich ihn bald in die Klarheit führen.
Weiß doch der Gärtner, wenn das Bäumchen grünt,
Das Blüt und Frucht die künft’gen Jahre zieren.
Mephistopheles:
Was wettet Ihr? den sollt Ihr noch verlieren!
Wenn Ihr mir die Erlaubnis gebt,
Ihn meine Straße sacht zu führen.
DER HERR:
Solang er auf der Erde lebt,
So lange sei dir’s nicht verboten,
Es irrt der Mensch so lang er strebt.
Mephistopheles:
Da dank ich Euch; denn mit den Toten
Hab ich mich niemals gern befangen.
Am meisten lieb ich mir die vollen, frischen Wangen.
Für einem Leichnam bin ich nicht zu Haus;
Mir geht es wie der Katze mit der Maus.
DER HERR:
Nun gut, es sei dir überlassen!
Zieh diesen Geist von seinem Urquell ab,
Und führ ihn, kannst du ihn erfassen,
Auf deinem Wege mit herab,
Und steh beschämt, wenn du bekennen mußt:
Ein guter Mensch, in seinem dunklen Drange,
Ist sich des rechten Weges wohl bewußt.
Mephistopheles:
Schon gut! nur dauert es nicht lange.
Mir ist für meine Wette gar nicht bange.
Wenn ich zu meinem Zweck gelange,
Erlaubt Ihr mir Triumph aus voller Brust.
Staub soll er fressen, und mit Lust,
Wie meine Muhme, die berühmte Schlange.
DER HERR:
Du darfst auch da nur frei erscheinen;
Ich habe deinesgleichen nie gehaßt.
Von allen Geistern, die verneinen,
ist mir der Schalk am wenigsten zur Last.
Des Menschen Tätigkeit kann allzu leicht erschlaffen,
er liebt sich bald die unbedingte Ruh;
Drum geb ich gern ihm den Gesellen zu,
Der reizt und wirkt und muß als Teufel schaffen.
Doch ihr, die echten Göttersöhne,
Erfreut euch der lebendig reichen Schöne!
Das Werdende, das ewig wirkt und lebt,
Umfass euch mit der Liebe holden Schranken,
Und was in schwankender Erscheinung schwebt,
Befestigt mit dauernden Gedanken!
Mephistopheles:
Von Zeit zu Zeit seh ich den Alten gern,
Und hüte mich, mit ihm zu brechen.
Es ist gar hübsch von einem großen Herrn,
So menschlich mit dem Teufel selbst zu sprechen.
Mephistopheles, der Teufel, ist nicht Gegenspieler Gottes,
sondern ebenso sein Diener wie die drei Erzengel. Er ist von Anfang an „ein Teil des Teils“ eines Ganzen und hat somit auch seinen festen Platz in der göttlichen Weltordnung. Er hat die konkrete Aufgabe, den Menschen in Versuchung zu führen, um ihn nicht zur Ruhe kommen zu lassen. Dieses Irren des Menschen wird dadurch legitimiert, dass es dem höheren Zweck dient, weiterhin nach dem übergeordneten Guten, Vollkommenen zu streben. Demnach muss sich der Mensch seinen Versuchungen stellen, um zu einer höheren Erkenntnis zu gelangen. Die christliche Lehre, nach der sich der Mensch durch die Versuchung versündigt, wird damit kritisch unterlaufen.
Anders als in der christlichen Vorstellung, in der das Böse nicht mit dem Guten, der Allmacht Gottes, zu vereinen ist, agiert der Teufel im „Faust I“ im Einverständnis Gottes. Goethe stellt damit die fundamentale Frage, was das Böse ist und wie es sich zeigen kann, aus einem anderen Verständnis heraus. Das Böse ist ebenso Bestandteil einer allumfassenden harmonischen Ordnung wie das Gute, so wie Tag und Nacht, Licht und Dunkel im Wechselspiel zueinanderstehen.
Der Mensch hat in dieser geordneten Gesetzmäßigkeit seine feste Funktion, wie alle Elemente und Teile des Universums. Dieses Weltbild zeigt sich auch in den Motiven der Magie. Auf der Suche nach einem höheren göttlichen Prinzip beschwört Faust die Erdgeister und studiert das Zeichen des Makrokosmos.
Diese auf Ganzheit ausgerichtete Idee beinhaltet auch die Vorstellung, dass sich das Göttliche in allen Erscheinungen des Daseins zeigt, vor allem in der Natur, in der Schöpfung Gottes.
Dieser auch pantheistische Grundgedanke zeigt sich im Faust sehr deutlich, etwa in der Szene „Wald und Höhle“, in der Faust eine tiefe göttlich-spirituelle Verbundenheit mit der Natur erfährt. Nicht das Wort Gottes, sondern seine Tat, seine Schöpfung ist dabei der Ausgangspunkt allen Seins. Faust hat durch das Wort der „toten“ Materie der Wissenschaft keine Lebenserkenntnis gewonnen. Bezeichnenderweise übersetzt er deshalb die Anfangsverse der Bibel neu und ersetzt „Am Anfang war das Wort“ mit „Am Anfang war die Tat.“
Sich nicht zur Ruhe zu setzen, sondern weiterhin tätig zu sein und nach neuer Erkenntnis zu streben, wird damit zur Lebensmaxime des Menschen, die Faust repräsentativ darstellt.
Seit der Antike bis in die heutigen Tage ist in der metaphysischen Ideenlehre die Idee des Guten die höchste Instanz. In der höchsten Instanz sieht man die höchste Idee, aus der alle gewöhnlichen Ideen hervorgehen. Die Idee des Guten, so nimmt man an, verleiht den Ideen Sinn und Wesen. Die Idee des Guten gewährt den Dingen Erkennbarkeit, dem Erkennenden seine Erkenntnisfähigkeit, allem Seienden sein Sein und allem seinen Nutzen.
In Religionen nimmt das absolut Gute als höchste Instanz eine überweltliche Position ein. An ihm und seinen Gesetzen müssen sich alle Dinge und Wesen, bis hin zum Menschen und seinen Werken, messen lassen.
Das Gute im Geist der Moderne ist ein Mix aus historischen Anschauungen unter dem Primat des rationalen Denkens. Heute bedeutet im allgemeinen Sprachgebrauch das Gute sowohl moralisch gut, als auch qualitativ hochwertig.
Religionsphilosophisch lassen sich zwei Formen des Bösen unterscheiden: einerseits Böses in der menschlichen Sphäre, andererseits geistige Mächte oder Kräfte, die in schädlicher Weise wirken oder denen in ethischer Hinsicht schlechte Einflüsse zu eigen sind – das „numinose Böse“.
Werden manche Menschen bereits als böse geboren?
Wer Menschen liebt, neigt zu der Annahme, dass keiner als böse geboren wird. Zweifellos ist ein neugeborenes Kind weder gut noch böse. Durch geschickte Erziehung kann daraus ein guter Mensch werden, andernfalls wird er vielleicht ein böser. Zunächst hat ein Kind kein Bewusstsein und keinen Willen. Es ist zufrieden, wenn seine Grundbedürfnisse erfüllt werden. Erst, wenn es anfängt, die Reaktionen aus der Umwelt auf seine Äußerungen zu registrieren, erwachen der Wille zum Angenehmen und der zur Ablehnung des Unangenehmen.
Allmählich baut das Kind mit Geschick ein Manipulationssystem zur Durchsetzung seines Willens auf. Fallen seine Erzieher darauf herein, wird daraus ein verwöhntes Kind und später wahrscheinlich ein unangenehmer oder labiler Erwachsener. So ein fehlgeleiteter Erwachsener muss aber deshalb nicht erzböse sein. Ein erzböser Mensch würde sehr wahrscheinlich seine gute Erziehung zur Erreichung seiner bösen Absichten nutzen.
Für die Vermutung, dass es erzböse Menschen geben kann, spricht Nero, der römische Kaiser. Sein Erzieher war Seneca, der weiseste Mann seiner Zeit und das beste Vorbild für Güte und Moral. Beste Bildung und kaiserliche Macht gaben seinem Zögling einen grenzenlosen Handlungsspielraum zum Ausleben seiner Erzbosheit, der dann schließlich auch sein Erzieher zum Opfer fiel, indem ihn Nero zum Selbstmord zwang.
Die Natur selber zeigt: Von Anfang an kämpfen Evolution
(Aufbau) und Involution (Abbau) gegeneinander.
Aus der dynamisch ausgewogenen Gewichtung dieser Gegensätze am Schöpfungsanfang entstand unsere Welt. Auch der Mensch besteht in seinem Wesenskern aus diesen Gegensätzen. Offensichtlich befinden sich nicht bei jedem Menschen die Gegensätze in einem gesunden Verhältnis zueinander. Vielleicht haben gravierende Erlebnisse das anfänglich natürliche Verhältnis verschoben. Wie dem auch sei, Gutes und Böses oder besser gesagt Gutes und Schlechtes gehören von Natur aus zusammen, sie sind die Urkräfte des gegenständlichen Seins und des Lebens.
Diese Tatsache bürdet uns eine große Verantwortung auf: Wir haben im eigenen Interesse und auch im Interesse der Allgemeinheit, heute sogar der globalen, dafür zu sorgen, dass das Böse bzw. das Schlechte nicht überhandnimmt, sondern weiterhin als dynamische Kraft dem Leben dient.
27.06.2024
Roland R. Ropers
Religionsphilosoph, spiritueller Sprachforscher, Buchautor und Publizist
Über Roland R. Ropers
Roland R. Ropers geb. 1945, Religionsphilosoph, spiritueller Sprachforscher,
Begründer der Etymosophie, Buchautor und Publizist, autorisierter Kontemplationslehrer, weltweite Seminar- und Vortragstätigkeit.
Es ist ein uraltes Geheimnis, dass die stille Einkehr in der Natur zum tiefgreifenden Heil-Sein führt.
>>> zum Autorenprofil
Buch Tipp:
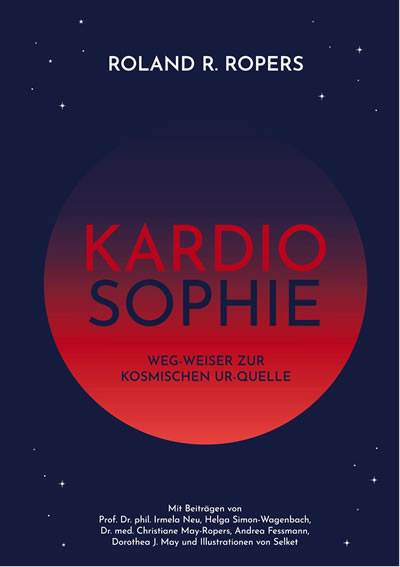
Weg-Weiser zur kosmischen Ur-Quelle
von Roland R. Ropers und
Andrea Fessmann, Dorothea J. May, Dr. med. Christiane May-Ropers, Helga Simon-Wagenbach, Prof. Dr. phil. Irmela Neu
Die intellektuelle Kopflastigkeit, die über Jahrhunderte mit dem Begriff des französischen Philosophen René Descartes (1596 – 1650) „Cogito ergo sum“ („Ich denke, also bin ich“) verbunden war, erfordert für den Menschen der Zukunft eine neue Ausrichtung auf die Kraft und Weisheit des Herzens, die mit dem von Roland R. Ropers in die Welt gebrachten Wortes „KARDIOSOPHIE“ verbunden ist. Bereits Antoine de Saint-Exupéry beglückte uns mit seiner Erkenntnis: „Man sieht nur mit dem Herzen gut“. Der Autor und die sechs Co-Autorinnen beleuchten aus ihrem individuellen Erfahrungsreichtum die Vielfalt von Wissen und Weisheit aus dem Großraum des Herzens.
> Jetzt ansehen und bestellen <<<

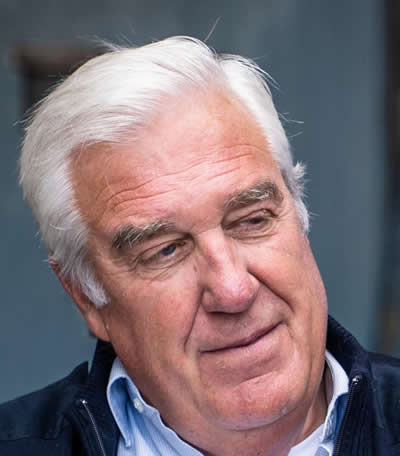



Hinterlasse jetzt einen Kommentar