
Hortus Conclusus – Wenn Wissenschaft den Glauben entmachtet
Der „Hortus Conclusus“ – der verschlossene Garten – war über Jahrhunderte ein Sinnbild für göttliche Vollkommenheit, für Reinheit, für die unberührte Sphäre des Glaubens. Heute jedoch bebt der Boden unter seinen Mauern: Die Wissenschaft, bewaffnet mit Mikroskop und Teilchenbeschleuniger, rüttelt an jedem Stein, prüft jedes Blatt, entmystifiziert jedes Wunder. Was einst ein stiller Ort jenseits der Vernunft war, wird nun von der Logik vermessen, von der Analyse entkleidet.
Das Haus des christlichen Gottes liegt in Trümmern, gefällt von der Abrissbirne der fröhlichen Wissenschaft. Und alle Axiome unter dem Deckmantel vatikanischer Dogmen erscheinen uns wie Hekubas Gebell. Denn die größte Herausforderung unseres Lebens ist das Bewusstsein des Todes – und zwar nicht nur des eigenen. Der Tod jedoch ist ein dem Leben stets entrückter Garten; und die Religion das diesseitige Pfeifen der Sterblichen im gewiss ungewissen Wald der Sterblichkeit. Alles Leben ist Verlust und Überwindung; und schlussendlich überwinden und verlieren wir sogar das Leben selbst – und damit oft auch uns in ihm.
Wahrheit oder Wunsch? – Glaube zwischen Tradition und Forschung
Doch woran soll der Mensch dann glauben? Und warum will er es so sehr? Der Mensch, mal homo mensura, mal paläontologisches Objekt, scheint stets wie neu in die Welt geworfen. Er muss sich anthropozentrisch und auf der Suche nach dem archimedischen Punkt zwischen Katechismus und Teilchenbeschleunigern, zwischen Higgs-Bosonen und identitätsstiftenden Sakramenten zurechtfinden.
Vom Tode gebissen, zerfällt er am Ende seiner Schönheit zu Staub – wie der Sabellus des Cato Uticensis. Und gerade dieser Mensch wird durch den fehlerhaften Kreisschluss Gott, bei dem Gott vom zu Beweisenden auf dasselbe zurückgeschlossen wird, ebenso verunsichert wie durch den horror vacui oder den zweiten Tod postmortem.
Alle mehr oder weniger exakten Wissenschaften wollen sich der Wahrheit annähern. Deshalb liegt an den Grenzen der Wissenschaften oft nicht das Wissen, sondern das Wollen. Der Glaube ist per definitionem also nicht Wissen, sondern glauben Wollen: nicht Wahrheit also, sondern Wunsch.
Grenzen der Erkenntnis – Wenn Gott jenseits des Messbaren bleibt
Die Wissenschaft, ein in sich schlüssiges System, kann und wird – ihrer eigenen Hybris zum Hohn – Gott weder widerlegen noch beweisen. Eine kopernikanische Wende der Wissenschaft wird es in der Gottesfrage daher nicht geben, denn das, was der gemeine Mensch Gott nennt, liegt jenseits dessen, was Wissenschaft erkennen kann – jenseits dessen also, was Wissen schafft. Und was sie erkennen kann, ist, obwohl heliozentrisch, doch nur der finstere Schatten eines schemenhaft erleuchteten Gegenstandes, der ihn wirft.
Es ist naiv, auf einen Paradigmenwechsel in der Wissenschaft zu warten, denn die Wissenschaft selbst ist der Paradigmenwechsel – und damit Mörderin des Himmels und der Hölle.
Der Kampf um Hoffnung – Wissenschaftslogik vs. Unsterblichkeitsglaube
Der Glaube – das An-Gott-Glauben – ist ein Prinzip, das die Möglichkeit Gottes verwirklicht. Solange man die Existenzmöglichkeit Gottes nicht im Glauben verwirklicht, bleibt man also nur der Möglichkeit nach ein Glaubender. Erst der in die Tat umgesetzte, also der verwirklichte Glaube, erfüllt dieses Prinzip tatsächlich.
Wo die Wissenschaft die Hoffnung auf das Neue hegt, hütet der Glaube ängstlich seine Tradition. Der methodische Zweifel – das systematische Infragestellen ungetesteter Annahmen – ist dem Glauben fremd, der seinen Gott verteidigt und dadurch oft ungewollt herabsetzt.
Von der Seele zum Synapsenfeuer
Für die aufstrebende Neurowissenschaft ist die menschliche Seele ein Synonym für die Forschungsgebiete des Denkens. Sie erklärt Gedächtnis und Erinnerung in neuronalen Spuren, in Neuro-Enhancements und synaptischen Kontakten. Gleichzeitig beschwört sie unseren Glauben an die Macht der Verhaltensdeterminanten und der Bildkraft der modernen Zeit.
Der Zeit hingegen ist nichts modern, denn sie ist die maßgebliche Größe und unveränderliche Konstante aller Veränderung. Sie bedingt die Expansion des Universums, dessen Fluss strikt in eine Richtung gerichtet ist. Daher zählt die Reise durch die Zeit – das Sich-senkrecht-zur-Zeitkausalität-Bewegen – zu den hartnäckigen Visionen der gesamten Menschheit.
Götter, Gestirne und der Blick in die Vergangenheit
Der Mensch wendet sich in seiner Sehnsucht an die Natur, an die Götter und Gestirne und blickt hoch zum Firmament. Doch was er dort sieht, ist reinste Vergangenheit: Das Licht von Mond und Sonne, die Strahlen aus Andromeda und Milchstraße sind Sekunden, Minuten und sogar Millionen Jahre alt. Sie reichen zurück in eine Epoche, in der es uns Menschen, glaubt man der Wissenschaft, noch gar nicht gab.
Doch was tut der Mensch mit seiner Endlichkeit und einer Ahnung solcher Größe? Er sucht Halt in Kunst und Gott, in Religion, Wissenschaft und Aberglaube. Unser Unglaube gegenüber der Endlichkeit und unser Drang nach Verewigung sind jedoch alles andere als sinnlos, denn sie fördern das Dionysische und das Apollinische in uns zutage.
Ziel oder Weg? – Die Suche im Angesicht der Endlichkeit
Ein Mensch von Geist, ein uomo universale, soll auf den Wegen Gottes wandeln, damit er – auch wenn er Gott nicht erreicht – doch wenigstens in seinem Geiste handelt, sagte die Renaissance. Ist also der Weg das Ziel? Nein. Ein Mensch von Geist muss zweifeln, er muss Gott schauen wollen, er muss die ihm von Gott gegebenen Talente mehren wollen – denn sein Weg wird erst durch ein Ziel zum Ziel. Ein Weg ohne Ziel bleibt immer nur ein Weg, und der Mensch braucht ein Ziel, denn er will, so lernten wir, noch eher das Nichts wollen, als nicht wollen.
Der befremdlichste Glaube – An einen Gott ohne Zeichen

Weil der Mensch nicht nur wollen, sondern auch wissen, glauben und hoffen will, schafft er sich Religionen und Utilitarismen, die nicht länger im Widerspruch zu den jeweiligen Wissenschaften stehen. Der eine Gott bleibt dabei Schöpfer und Urgrund der Welt, greift jedoch nicht in den Ablauf des natürlichen Weltgeschehens ein – weder durch Wunder noch durch Offenbarung.
Und dieses ist, et in Arcadia ego, fürwahr die reinste, aber auch die befremdlichste Form des Glaubens: nämlich an einen Gott zu glauben, der keinem Menschen je ein Zeichen gab; an einen Gott, der uns das Privileg des scheinbar freien Willens und des unbedingten Strebens nach Freiheit gewährt hat und uns dennoch den Blick auf das Vorher und das Nachher unseres Lebens verweigert.
Warum wir glauben wollen
Die Erkenntnis unserer Endlichkeit formt alles: Zeit, Tod, Seele, Gott. Sie ist das bewegende Momentum des Menschseins. Das Bewusstwerden unserer Endlichkeit beendet unsere Unmündigkeit, denn in uns allen steckt ein Kind, das jeden Tag mit Zaubersprüchen – seien sie sokratischer, christlicher oder wissenschaftlicher Natur – von der Furcht vor dem Tode geheilt werden will.
Die Evolution verlangt nicht die Unsterblichkeit der Seele, nur den Fortbestand der Gene. Und doch wollen wir leben – und glauben. Vielleicht ist die ehrlichste Antwort auf die Frage „Warum glaubst du an Gott?“:
„Weil ich es will; weil es mir Mut macht und Hoffnung schenkt.“
FAQ
1. Was bedeutet „Hortus Conclusus“?
Ein ummauerter, verschlossener Garten, Symbol für Reinheit, Paradies und spirituelle Vollkommenheit in der christlichen Kunst und Theologie.
2. Wie wirkt Wissenschaft auf den Glauben?
Sie stellt traditionelle Glaubensgewissheiten in Frage, entmythologisiert religiöse Bilder und verschiebt die Deutungsmacht.
3. Warum bleibt das Thema aktuell?
Weil der Mensch im Spannungsfeld zwischen wissenschaftlicher Rationalität und spirituellem Bedürfnis nach Sinn und Halt lebt.
09.08.2025
Claus Eckermann
Sprachwissenschaftler und HypnosystemCoach®
Kurzvita HSC Claus Eckermann FRSA
Claus Eckermann ist ein deutscher Sprachwissenschaftler und HypnosystemCoach®, der u.a. am Departements Sprach- und Literaturwissenschaften der Philosophisch-Historischen Fakultät der Universität Basel und der Theodor-Heuss-Akademie der Friedrich-Naumann-Stiftung unterrichtet hat.
Er ist spezialisiert auf die Analyse von Sprache, Körpersprache, nonverbaler Kommunikation und Emotionen. Indexierte Publikationen in den Katalogen der Universitäten Princeton, Stanford, Harvard und Berkeley.



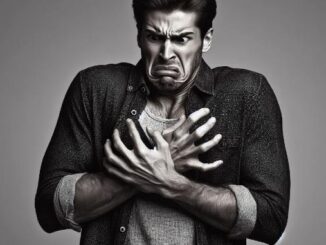

Hinterlasse jetzt einen Kommentar