
 Zeit und Universum linear oder zyklisch?
Zeit und Universum linear oder zyklisch?
– das Fortschreitende und die Ordnung -Lineare und zyklische Zeitrechnungen. Von Prof. Dipl. Chem. Waltraud Wagner.
Prof. Wagner unterscheidet zwischen der physikalischen Zeitmessung der konventionellen Wissenschaft und der Zeitpunktbestimmung im Verständnis der traditionellen Kulturen und der Biophysik.
Zeit ist nicht linear sondern zyklisch. So zeigt sich die Übereinstimmung der Phasenqualitäten von Kreisläufen auf physikalischer und geistiger Ebene. Zeit und Universum eine ständige Herausforderung!
Raum und Zeit sind Voraussetzungen
für die Existenz des Universums und bedingen sich gegenseitig. Daraus ergeben sich die gegenseitige Bedingtheit bzw. Äquivalenz von Masse und Energie, Teilchen und Welle, Beständigkeit und Veränderlichkeit und daß alle Phänomene im Universum als dynamische Strukturen beschrieben werden können.
Diese Gegebenheiten können durch kleine Experimente zum Raum- und Zeiterleben erfahrbar gemacht werden.
Zeitmessung und Zeitpunktbestimmung
– quantitative und qualitative Aspekte der Zeit
»Die Hopi-Indianer haben noch nicht jene Distanz zum Naturgeschehen gefunden, die es ihnen ermöglicht, einen Zeitbegriff zu entwickeln, der unserem Begriff der gleichförmigen, physikalisch meßbaren Zeit entspräche.«
So formulierte es der Linguist Helmut Gipper in seinem 1972 erschienenen Buch. Gibt es ein sprachliches Relativitätsprinzip (G1).
Wenn auch diese Vorstellung von einer gleichförmigen, also linear fortschreitenden Zeit unser heutiges Leben beherrscht, war Herr Gipper damit auch 1972 nicht auf der Höhe naturwissenschaftlicher Einsichten, in denen das Thema Zeit unter verschiedenen Aspekten längst diskutiert wurde. So wurde in der Biophysik zwischen der physikalisch messbaren Zeit und der biologischen, durch Zeitpunkte definierten Zeit unterschieden.
Bei der physikalischen Zeitmessung werden Zeitabstände
zwischen zwei Zeitpunkten bestimmt.
Dafür gelten folgende Voraussetzungen:
- Der Nullpunkt ist willkürlich oder wirft die Frage nach einem Anfang des Universums auf.
- Wenn die Zeit gleichförmig verlaufen soll, sind zur Messung Einheiten absolut konstanter Dauer erforderlich; das heißt, rhythmische Vorgänge, die sich bis zum Ende des Universums unverändert wiederholen. Das müssen absolut reversible Vorgänge sein.
- Es ist aber auch ein Vorgang stetiger Veränderung in eine Richtung bis zum Ende des Universums erforderlich, denn sonst wäre der Zeitverlauf nicht gleichförmig. Es muss ein irreversibler Vorgang sein.
Die Zeitmessung gibt quantitative Werte für die Zeit,
enthält aber keine Aussage über das Wesen der Zeit.
Diese wäre nur über das Wesen der Veränderungen durch den irreversiblen Vorgang zu gewinnen.
Bei der Zeitpunktbestimmung ergibt sich die Zeit aus der Konstellation und wechselseitigen Beziehung der Dinge im betrachteten Augenblick, das heißt aus dem Strukturzustand in einer dynamischen Ordnung.
Der Augenblickszustand ergibt sich aus dem Ineinanderspiel rhythmischer Vorgänge und ihrer Phasenbeziehungen.
Voraussetzung ist, dass etwas über die wechselwirkenden Rhythmen, d.h. über ihre Bewegungsformen und Bedeutungen bekannt ist.
Die Zeitpunktbestimmung liefert eine unmittelbare Aussage über die Qualität der Zeit, also über das Wesen der Zeit, über die Bedeutung des Augenblicks. Sie ergibt sich aus der Kombination der Wirkungen der Phasenlagen aller sich überlagernden Rhythmen.
Diese unterschiedlichen Zeitauffassungen
haben weitreichende Auswirkungen auf das menschliche Verhalten und auf die Gesellschaftsordnungen.
In einer vergangenen Kulturepoche war das qualitative Zeitverständnis vorherrschend, und es bestimmt auch heute noch das Weltbild und die Zeitrechnung traditioneller Kulturen wie der indianischen.
So ist für den Indianer die Zeit durch einen dynamischen Ordnungszustand gegeben, durch die im ständigen Wechsel begriffenen Beziehungen der Dinge untereinander, in die auch der Beobachter einbezogen ist.
Für den Weißen, den gläubigen Bürger der heute weltbeherrschenden Zivilisation, ist die Zeit durch die Koordinate definiert, die diesen Ordnungszustand von einem anderen trennt. Es interessieren nur Zeitabstände, die mit möglichst genau definierbaren Einheiten gemessen werden.
Die Zeit wird rein quantitativ, als geradlinig fortschreitend verstanden. Den Zeitpunkten, der Situation des Augenblicks, wird keinerlei Bedeutung zugeordnet. Man kann alles zu beliebiger Zeit tun – was in der Landwirtschaft allerdings verheerende Folgen hat.
Der kanadische Indianer Wilfred Pelletier schreibt dazu in einer Betrachtung über die Zeit (P1,W1,W2):
»Mein Volk hatte eine endlose Kette von Terminen einzuhalten, aber sie hielten sie ein, wie der Fluss fließt und nicht, wie die Uhr tickt …
Sie mussten sehr genau auf die Zeit eingespielt sein. Sie mussten wissen, wann sich die Rinde leicht von den Birken abschälen ließ; wann die Lachse wieder in die Flüsse zurückkehrten; wann die verschiedenen Beeren reiften; wann man den wilden Reis ernten konnte … «
Weiter schreibt er über seine Auseinandersetzung mit der Zeit der Weißen:
»Mein Problem ist es, dass es mir nie möglich war, die Information zu erfahren, die meine Uhr mir liefert und für die sie konstruiert ist. Eine Uhr handelt von Stunden, Minuten und Sekunden, von Zeitabschnitten. Ich habe die Zeit nie in Abschnitten erlebt, und ich misstraue Dingen, die ich nicht selbst erfahren habe. Ich bezweifle ihre Existenz. Es liegt nicht daran, dass ich es nicht versucht hätte. Ich habe schon oft mit der Uhr in der Hand gesessen und den Sekundenzeiger beobachtet, wie er sich im Kreis bewegt. Manchmal habe ich bis zu einer Stunde gesessen, um eine Sekunde einzufangen.
Ich wollte bloß mal wirklich wissen, wie sie sich anfühlt. Es ist mir niemals gelungen. Dann habe ich mir gesagt:
›Na, die sind einfach zu schnell, die Sekunden. Ich versuch es mal mit Minuten.‹ . . .
Es hat nichts genützt. Ich habe nichts gefühlt. Es hätten genauso gut eine halbe Minute oder fünf sein können.
Die Wahrheit ist, dass sogar die besten Uhren keinen Fetzen Zeit enthalten. Zeit ist nicht in Zeitabschnitten. Zeit ist nicht in Stunden, Minuten und Sekunden. Zeit ist der ununterbrochene Zusammenhang der Erfahrung.«
Die Genauigkeit der Messung der Zeitabstände
hat für »die Weißen« allerdings größte Bedeutung.
So genügen längst nicht mehr die ursprünglich gewählten Rhythmen der Tages- und Jahreszyklen. Statt dessen wurden die konstanter erscheinenden Rhythmen hochfrequenter, elektromagnetischer Strahlung als Maßeinheiten der Zeit eingesetzt. Immer genauere Bestimmungen zur Festsetzung der Maßeinheiten werden erforderlich, und es wird zum Anliegen der Wissenschaft, die Welt in immer genauer definierbare Einheiten, Punkte und Pünktchen zu zerlegen, in der Hoffnung, einmal letzte, wirklich unveränderliche Teilchen zu finden.
Auf der gesellschaftlichen Ebene kommt dasselbe Bestreben in dem Bemühen zum Ausdruck, alles genau gesetzlich festzulegen, als könne man damit dem beunruhigenden Spielraum für eigene Entscheidungen und eigene Verantwortung entgehen.
Ein Gegenpol zur linearen Zeitauffassung bildet die rein zyklische Auffassung. Beide Einstellungen führen zur Erstarrung.
Die zyklische Zeitauffassung führt zu erstarrten Traditionen, die lineare zu starren Gesetzen. Das Universum und das Leben können sich nur in dem paradox erscheinenden Spiel zwischen Beständigkeit und Veränderlichkeit bilden und erhalten, sowie es das Spiel der Wellen in jedem Gewässer zeigt.
Der Biologe Karl Friedrichs schreibt dazu 1957 in einem Aufsatz (D1):
»So können wir also die Lebensgemeinschaft ein Beziehungsgefüge nennen, und ausserdem bildet sie als Ganzes ein Beziehungsgefüge höherer Ordnung mit ihrem Lebensraum zusammen. Denn auch der fruchtbare Boden ist ein kompliziertes Gefüge mit einer vielfältigen Flora von Bakterien und Pilzen darin, nebst einer Fauna von Protozoen und Würmern; die Tätigkeit dieser Wesen darin ist für die wurzelnde Pflanze unentbehrlich … – Wer könnte in Kürze dieses ganze äußerst verwickelte Gewebe von Beziehungen notwendiger Art schildern, die das Ganze der Lebenswelt überall auf der Erde zusammenhalten?
Alles steht zu allem darin direkt oder indirekt in Beziehung; zugleich findet sich alles darin in ständiger rhythmischer, dem Rhythmus der Tages- und Jahreszeiten entsprechender Bewegung und Veränderung, und alles vollzieht sich durch Selbstregulierung soweit in Harmonie, dass trotz allen Wechsels das ganze ungeheuer komplizierte System Dauerhaftigkeit hat. Dabei ist zu bemerken: Der Zusammenhang, die Einheit, die wir darin konstatieren, besteht nicht für den einzelnen isoliert gedachten Augenblick, sondern nur dann, wenn man die Zeitmomente zu einer Vorstellung zusammenfasst, erkennt man die Einheit der Natur, das Naturganze.
Man könnte das auch so ausdrücken: die Natur ist statisch gesehen uneinheitlich, erscheint nicht als etwas Ganzes; dynamisch ist sie einheitlich und ganz … «
Zwar ist inzwischen durch den Nachweis der Relationen zwischen Raum und Zeit
und durch die Erkenntnisse über Vorgänge in Systemen erwiesen, dass Zeit kein linearer, gleichförmiger Prozess zwischen statischen Gleichgewichtszuständen ist, sondern dass unser Universum als dynamische Ordnung gesehen werden muss.
Leider ist aber den Weißen im allgemeinen die Vorstellung von der Zeit als etwas, was geradlinig davonzulaufen scheint, so in Fleisch und Blut übergegangen, dass sie trotz aller wissenschaftlichen Erkenntnis unfähig bleiben, die Relationen der Dinge zueinander zu erkennen. Und so geht die »Forschung« weiter und weiter und liefert eine scheinbar explosionsartig zunehmende Fülle an neuen Informationen, was zum Teil daran liegt, dass die Zusammenhänge zwischen den Dingen nicht gesehen werden und daß die gleiche Sache, aus verschiedener Perspektive untersucht, immer wieder anders aussieht.
Vine Deloria, ein Nachkomme der Hugenotten und indianischen Dakota, Rechtsanwalt und Bestsellerautor, formuliert das so (D1,W1):
»Wenn wir eine lineare Perspektive von der Welt beziehen, dann erzeugt die Folge sichtbarer Ereignisse den Eindruck, dass es in der Welt entweder aufwärts oder abwärts geht. Es werden vielmehr die günstigen oder bedrohlichen Aspekte der Ereignisse notiert, als ihr Verhältnis zur Wirklichkeit, da sie nur in ihrem linearen Verhältnis zueinander gesehen werden und in sich selber keine Interpretationsmöglichkeit enthalten …
Man versteht nicht, dass eine Veränderung eines Elements einer Situation unausweichlich eine Veränderung aller anderen verursacht. Wenige haben begriffen, dass wir nicht länger als unparteiische und rationale Beobachter den Ereignissen gegenüberstehen, weil wir schon, wenn wir sie nur beobachten, zu Teilnehmern an diesen Ereignissen werden.
Mehr noch, wir sind aufs Intimste mit den Ereignissen verbundene Teile derselben, ob wir nun wollen oder nicht. Nichts ist wirklich relativ, alles steht in Relation zueinander.«
Den Prozess der Veränderung,
der dem Begriff Zeit überhaupt erst einen Sinn gibt, erfahren wir im Lauf der Tage, der Jahre und unseres Lebens. Die Prägung der Tage ändert sich im Laufe des Jahres, und die Prägung der Jahre ändert sich für uns individuell im Laufe des Älterwerdens. Wir erfahren den Zeitverlauf über rhythmische Abläufe (die längeren werden auch Perioden genannt), und dabei fügen sich kürzere Rhythmen in längere, in denen sie ihre Prägung verändern.
Die traditionellen Kulturen haben über den Jahreskreis hinaus ein viel weiterreichendes System längerer, kosmischer Rhythmen, die unsere Lebenszeit bei weitem überschreiten. In diesen Rhythmen oder Zyklen wiederholen sich bestimmte Phasen, aber nie ganz genau, weil sie sich im Lauf der überlagernden Rhythmen verändern.
Im Zeitverständnis »der Weißen« ist die Veränderung,
die doch einen gleichförmigen Zeitverlauf charakterisieren müsste, nur vage definiert, wie durch die Vorstellung einer Evolution des Universums und des Lebens zu bewussteren und »besseren« oder aber einfach nur »fitteren« Formen. Oder der Zeitlauf wird mit tatsächlich einseitig gerichteten, irreversiblen Veränderungen in Verbindung gebracht, die als Zunahme der Entropie bezeichnet und auch mit Zunahme an Unordnung gleichgesetzt werden. Die Entropie steht für das Verhältnis von Wärmeenergiegehalt zur Temperatur.
Irreversibel sind Vorgänge, wie der Ausgleich von heiß und kalt oder die Bewegung in einem anziehenden Kraftfeld auf das Zentrum zu und ganz allgemein das Bestreben nach Ausgleich und Nivellierung von Differenzierungen. Im Gegensatz dazu ist die Evolution des Lebens aber mit einer Zunahme an Differenzierungen und Ordnung verbunden.
Aber weder die Evolution noch die Zunahme der Entropie
sind stetige, gleichförmige Entwicklungen;
sie verlaufen vielmehr in Rhythmen, und zwar genau jenen Rhythmen, die Grundlage der Zeitpunktbestimmungen sind.
Denn auch die Entropie kann sich nur über Stufen verändern. Diese Bedingung ergibt sich u.a. aus der Quantenmechanik, wonach Wirkungen nur in Mindestportionen übertragen werden können, die der Dauer einer vollständigen Schwingung entsprechen.
Diese können nicht unterschritten werden, so dass Differenzen darunter bestehen bleiben können. Mit anderer Perspektive ergeben sich die Bedingungen für einen Energieaustausch auch aus der Systemtheorie, wonach Wechselwirkungen nur über Resonanzen von möglichen Eigenschwingungen erfolgen können. Mit dieser so gar nicht nebensächlichen Zusatzbedingung entpuppt sich die Zunahme der Entropie als Evolution von Ordnung in Richtung auf Symmetrie und im Sinne einer Harmonisierung und Synchronisierung dynamischer Ordnungszustände.
In der Biophysik gibt es Ansätze, die Quantelung zu berücksichtigen,
und das hört sich dann so an:
»Bei dieser Methode interessiert man sich mehr für den allgemeinen Typ der funktionalen Relation zwischen den Variablen, als für die exakte quantitative Bestimmung dieser Funktionen« (B1).
Etwas verständlicher erklärt der Biophysiker Ludger Rensing die Situation:
»Biologische Systeme weisen eine eigene zeitliche Organisation auf, in der Zeitpunkte festgelegt und Zeiteinheiten in Form von rhythmischen Prozessen vorhanden sind. Die Koordination biologischer Funktionen beruht wesentlich auf der Ordnung von Ereignissen nach bestimmten Zeitpunkten innerhalb von Rhythmen. Die Bedeutung dieser Zeitpunktsbestimmungen für die Funktionsfähigkeit von komplexen, geregelten Systemen ist sowohl im menschlichen Bereich wie in der Biologie hoch einzuschätzen.«
Bemerkenswert ist, dass in dieser Formulierung der »menschliche Bereich« (womit wohl der geistige gemeint sein muß) und der biologische gesondert aufgeführt werden. Ganz ausgeschlossen bleibt der anorganische Bereich, der ja als unbelebt angesehen wird.
Ganz anders in den Kulturen, die die Zeit generell als Ausdruck des Ordnungszustandes jedes Augenblicks auffassen. Da gibt es keine Trennung zwischen belebt, unbelebt und geistig. Der Ermittlung der »richtigen Zeit« wird in diesen Kulturen größte Aufmerksamkeit gewidmet.
Zur »richtigen Zeit« geschieht, was im Einklang mit den Zyklen des Universums und des Lebens geschieht.
Die Zeitrechnung passt sich in solchen Kulturen
dem wirklichen Phasenverlauf an;
die Dauer ist von höchstens nebensächlicher Bedeutung. Für die Lebensführung und für bestimmte Tätigkeiten ist die »richtige Zeit« maßgebend. Man muss alles zur richtigen Zeit tun!
Ich las einmal in einem Bericht eines aus meiner Sicht reichlich einfältigen Völkerkundlers über die Irokesen, dass diese ständig um ihre Gesundheit besorgt wären. Dabei ging es aber um mehr als die individuelle Gesundheit, wie wir sie verstehen, nämlich um eben dieses Gleichgewicht mit den Rhythmen des Lebens.
Wohl aber besteht bei dieser Zeitauffassung für bewusste Wesen ein Freiheitsraum, um Desynchronisation und Disharmonie oder Synchronisation und Harmonie zwischen rhythmischen Konstellationen zu bewirken. Es gibt jedoch keine einseitig gerichtete Entwicklung zum Besseren, vielmehr wiederholen sich bestimmte Konstellationen rhythmisch, variieren aber in ihren Erscheinungsformen.
Die Indianerin Gayle High-Pine erklärt das so:
»Unsere Zeitwahrnehmung ist sphärisch – es gibt keine Vergangenheit oder Zukunft, da sie eins sind mit der Gegenwart. Jeder Zeitpunkt ist er selbst – die einzigartige Wechselwirkung unendlich vieler Geschehnisse seit Anbeginn der Zeit – mit unendlich vielen Wirkungen. So wie jeder Punkt im Raum das Zentrum des Universums ist, so ist auch jeder Punkt in der Zeit das Zentrum der Zeit – der einzigartige und kostbare Augenblick, den die Erde seit ihrem Anbeginn vorbereitet hat.«
Die ›richtige Zeit‹ ist, ich möchte es noch einmal wiederholen, durch die Phase oder die Phasenkombination rhythmischer Abläufe bestimmt.
Die Anzahl der Rhythmen kann zwar als Koordinate zur Bestimmung der Phase eines langzeitigeren Rhythmus herangezogen werden, so wie man mit der Zahl der Tage seit der Wintersonnenwende ausrechnen kann, wann der Frühling beginnt. Man kann diesen Zeitpunkt aber auch direkt, aus bestimmten, dafür charakteristischen Phänomenen bestimmen, und in diesen Phänomenen drückt sich für den Indianer das Wesen der Zeit aus. Für den Weißen liegt dagegen das Wesen der Zeit in der Dauer und im gleichförmigen Fortschreiten.
Auf der Suche nach dem, was da »fortschreitet«, findet sich aber schließlich genau der durch das Zusammenspiel von Rhythmen gegebene Ordnungszustand, der die Zeit der Indianer und anderer traditioneller Kulturen bestimmt. Die Trennung zwischen unbelebt, belebt und geistig erweist sich bei genauerer Betrachtung auch als unhaltbar, denn im gesamten Universum gibt es nichts Statisches, alles ist im Fluss, in ständiger Veränderung und Wechselwirkung miteinander, so wie Vine Deloria es ausdrückt:
»Nichts ist relativ, alles steht in Relation zueinander.«
Es gibt keinen statischen, thermodynamischen Gleichgewichtszustand, auf den die Entropiezunahme hinsteuert. Alles ist Teil einer komplexen dynamischen Ordnung und dort, wo sie sich in Fließgleichgewichten stabilisieren kann, können sich die immer in ihr verborgenen geistigen Qualitäten entfalten, so wie sich unsere Gedanken beim Erwachen ordnen.
Kreislaufsysteme, ihre Eigenschaften und die Gesetze,
nach denen sie verlaufen. Ich möchte noch einmal von den westlichen Naturwissenschaften ausgehen, die ein Weltbild entwickelt haben, wonach die Grundzustände aller Phänomene statisch gesehen werden und Bewegungen und Veränderungen, Fließvorgänge und Reaktionen nur als Übergänge zwischen diesen an sich statischen, stabilen Zuständen aufgefasst werden. Man unterscheidet zwischen einer toten, anorganischen und einer lebenden, organischen Welt.
Die Lebensvorgänge, die Entwicklung und das Wachstum der Formen und die Wahrnehmungsvorgänge sind auf dieser Basis nicht zu verstehen. Es war unter anderen der Biologe Ludwig von Bertalanffy, der das Fliessgeschehen wieder in den Vordergrund rückte und in der »Allgemeinen Systemtheorie« formulierte (B2 bis B4).
Systeme sind demnach »eine Menge von Elementen«,
zwischen denen Wechselwirkungen bestehen. Um sie zu verstehen, muss man sowohl die Eigenschaften ihrer Elemente kennen als auch die Art ihrer Wechselwirkungen untereinander. Wechselwirkungen bewegen sich zwischen zwei Polen, und daraus ergeben sich Kreislaufprozesse, die selbst auch Systeme sind. Auch die »Elemente« in Systemen sind nichts Statisches, sondern rhythmische Prozesse, also auch Kreislaufprozesse.
Sie verändern sich durch die Wechselwirkungen, so dass kein Element einen sich genau wiederholenden Kreislauf bildet. Soweit, wie sie in sich selbst zurücklaufen, haben sie etwas in sich Abgeschlossenes, Individuelles und erscheinen als beständige Elemente. Beständige Elemente und Wechselwirkungen sind zwei sich bedingende Aspekte von Kreislaufprozessen, und alle physikalischen Phänomene sind sowohl Systeme als auch Teile von Systemen.
Es fügt sich Kreislauf in Kreislauf, System in System.
Auf der Ebene der elementarsten Strukturen des Universums
werden Elemente und Wechselwirkungen. Völlig identisch und erscheinen, komplementärpolar, je nach Perspektive und Grössenordnung des Beobachters, entweder als Teilchen oder Welle. Das Teilchen repräsentiert dabei Beständigkeit und die Welle Veränderlichkeit und Reaktionsfähigkeit. Der Begriff »komplementärpolar« ist als Betonung der polaren Beziehung gemeint, die gegensätzlich und doch sich gegenseitig bedingend ist.
Zwar kann man alle physikalischen Vorgänge sowohl als Übertragung von Teilchen als auch als solche von Schwingungen beschreiben; das erste Verfahren entspricht dem statischen, das zweite dem dynamischen Aspekt, doch ist je nach Fragestellung das eine oder das andere sinnvoller.
So ist es sinnvoll, etwas als Teilchen oder Bauelement zu betrachten,
wenn es im Verhältnis zu einem Beobachter oder auch Reaktionspartner um Zehnerpotenzen kleiner ist, wie für uns ein Molekül, oder wenn die inneren Bewegungen eines betrachteten Systems relativ sehr schnell sind, wie für uns schon ein Propeller auf Hochtouren (dann fasst man besser nicht hinein).
In solchen Fällen machen sich die Differenzierungen in den unterschiedlichen Phasen des Kreislaufs nicht bemerkbar.
Auch für Anordnungen, bei denen sich innerhalb von Kreisläufen die Wirkungen, die von verschiedenen Phasen ausgehen, innerlich kompensieren, kann es sinnvoll sein, sie als ein geschlossenes, ganzes Element zu behandeln. Solche sich kompensierenden Wirkungen werden dann zu inneren Strukturen, die sich nach außen nicht oder nur in innigster Nähe bemerkbar machen. So kompensieren sich für uns in Atomen und Molekülen die elektrischen Ladungen, so daß wir sie als neutrale Materie erfahren.
Das Neutron und viele Atome haben aber noch Magnetfelder,
weil sich der Drehsinn der Ladungen in ihnen nicht kompensiert. So erscheinen uns viele Eigenschaften in unserer Welt als voneinander unabhängig zu existieren und bedingen einander doch in quantitativ berechenbarer Weise, wie eben Magnetismus und Elektrizität. Das wird aber erst erkennbar, wenn man solche Systeme nicht als Teilchen, sondern als Prozesse betrachtet. Für das Verständnis von Nahwirkungseffekten ist es also unabdingbar erforderlich, sie als Kreislaufprozesse zu behandeln.
Es ist praktisch, chemische Vorgänge stofflich, als Kombinationen oder als Austausch von Atomen oder Ionen zu formulieren, aber das Wesen der chemischen Bindungen und der unterschiedlichen chemischen Eigenschaften ist so nicht zu verstehen. Gesetze von Wechselwirkungsvorgängen werden erst bei einer dynamischen Betrachtungsweise erkennbar.
Das Hervortreten der Farben bei der Wechselwirkung von Lichtstrahlen ist nur durch Interferenzen, durch Überlagerung von Wellen zu erklären. Die Harmonien der Musik lassen sich nicht mit Phononen = Schallteilchen erklären, so wenig, wie die Bedeutung der Synchronisation für das Zusammenspiel biologischer Rhythmen.
Ideale Teilchen können überhaupt keine Wirkungen übertragen,
da sie isolierte Kreisläufe sind. Es sind vielmehr die Schwingungen, die sie mit sich tragen, die miteinander wechselwirken. Die Teilchen fungieren lediglich wie Gefäße, die die Schwingungen tragen. Wenn man solche Schwingungen über Teilchen interpretieren will, erscheinen sie als Unbestimmtheitsbereiche, die die wahrscheinliche Verteilung von Teilchen beschreiben, und der »Zufall« kommt ins Spiel.
So erscheint bei einer Betonung des statischen Aspekts der Phänomene das ganze Universum als eine nur zufällige, vorübergehende »Fluktuation« ohne Sinn, und das ergibt eine sehr destruktive Perspektive unserer Existenz.
Begreift man das Universum dagegen als ein grosses System im Fluss,
so bleiben immer Differenzierungen oder, anders ausgedrückt, Asymmetrien erhalten, die, nach Ausgleich strebend, Kräfte bedingen und Bewegungen auslösen, in denen sich immer wieder neue Formen bilden können.
Eine andere Antwort auf die Frage nach der Entstehung und Entwicklungsrichtung des Universums, die in Übereinstimmung mit den wohl verstandenen Erkenntnissen heutiger Naturwissenschaft ist und nicht Sinnlosigkeit propagiert, findet sich im Schöpfungsmythos der Navaho-Indianer in einer Wiedergabe von G. Konitzky (K1):
»Die siebente Welt aber ist das große All, wo alle Einzelheiten zu einer Einheit werden, wo Form und Gestalt zerrinnen zu einem Nichts, das in Wirklichkeit ein Alles ist, denn alles kommt aus dem Nichts. Einst wird alles, was jetzt getrennt ist, verschmelzen zu diesem einen All, das in der siebenten Welt ist und über die übrigen Welten gebieten wird.«
Phasen von Kreislaufprozessen und Zeitaspekte
In Systemen laufen viele Vorgänge nach Gesetzen ab, die unabhängig von der Art des Systems sind, ganz gleich, ob es sich dabei um einen technischen Regelkreis, um den Kreislauf des Wassers, um die Wechselwirkung, die eine Bindung vermittelt, die Drehung der Erde oder um das Werden und Vergehen eines lebenden Organismus handelt. Dieselben Gesetze steuern große sowie kleine Kreisläufe.
So bilden sich im Großen wie im Kleinen ähnliche Formen, wie es im Wasser, in Wolken und in den Formen von Gesteinen und der lebenden Wesen sichtbar wird. In alten Kulturen wurden die Zeitaspekte im wesentlichen aus den Phasen der Sonnen- und Mondzyklen gewonnen. Sie wurden durch die verschiedensten Eigenschaften charakterisiert und geistig als Götter oder Engel gesehen.
Das Wort »Engel« hat dieselbe Wurzel wie »Winkel«, was im Englischen mit »angel« und »angle« besonders deutlich wird. Es ist interessant, dass sich mit Hilfe der heutigen Naturwissenschaften verschiedene physikalische und chemische Zustände finden lassen, die diesen Phasen zuzuordnen sind.
Einfachste Kreislaufprozesse sind mechanische Schwingungen,
wie die eines Pendels oder einer Wasserwelle. Dabei wechselt die Energie ihre Erscheinungsform zwischen Energie der Bewegung und Energie der Lage. So ergeben sich vier Phasen, nämlich die der reinen Bewegungsenergie, die der reinen Lageenergie und die, wo beide Energieformen gleich groß sind.
Die Energie der Lage ist statisch, sie ist die Energie eines Ruhezustands, den Schwingungen für kurze Zeit in ihren Extremwerten erreichen. Die Energie ist dann in einem Kraftfeld gespeichert. Sie bestimmt die Form des Raumes, in dem sie potentiell Bewegungen auslösen kann. Wir können sie über ihre beschleunigende Wirkung oder als Spannung wahrnehmen oder auch als äußere Form einer Bewegung. Sie ist dann in einem rein räumlichen Zustand und Ausdruck der räumlichen Form und Struktur einer Schwingung.
Ihr Gegenpol ist die Energie der Bewegung,
und diese bestimmt die Geschwindigkeit und den Rhythmus von Schwingungen. In ihr tritt die Zeit in Erscheinung und wird über die Rhythmen von Schwingungen meßbar. Form und Rhythmus, Raum und Zeit sind entgegengesetzte Pole in Kreislaufprozessen und bedingen sich gegenseitig. Sie treten meist in zeitlichem Wechsel in den Vordergrund und mit ihnen Zeiten der Ruhe und Zeiten der Aktivität.
Die Beziehung zum Jahres- oder Tageskreislauf ist unschwer zu erkennen und auch die Beziehung zum Wachstum von Pflanzen. Es mag aber überraschen, dass der Mittag und die Sommersonnenwende dem ruhenden Pol zuzuordnen sind, denn das ist die Zeit höchster Formentfaltung. Wie schlagartig sich dieser Wendepunkt bemerkbar macht, weiß der Gärtner, denn manche Pflanzen keimen und wachsen danach nur noch zögernd. (Das gilt jedoch nicht allgemein).
Was uns als Form und was als rhythmische Bewegung erscheint, ist aber auch von unserer Perspektive, unserer Entfernung und Eigenbewegung sowie von der Geschwindigkeit unserer Wahrnehmung abhängig.
Besonders eindrucksvoll wird der Wechsel
zwischen Phasen der Bewegung und Phasen der Ruhe in den Schwingungen der Wellen am Meeresstrand erlebbar. Im Wechsel zwischen Anschwellen, Herabstürzen und Verebben der Wellen werden Auf- und Abbau, Entwicklung und Zerfall von Formen als Polaritäten erkennbar. Aus der Nähe nehmen wir vor allem die Bewegung wahr, aus der Ferne, von einem Berge aus, wird auch bei stürmisch bewegtem Meer eine erstarrt wirkende Struktur erkennbar.
Wellen schwingen aber nicht nur auf und ab, sondern auch hin und her, drehen sich und bilden senkrechte und transversale Wirbel. Von jeder dieser Bewegungen gehen drückende oder saugende, abstoßende oder anziehende Kräfte aus, die in und gegen die Bewegungsrichtung und senkrecht dazu wirken.
Die von solchen Bewegungsformen ausgehenden Wirkungen benennen wir unterschiedlich als Gravitation, elektrische und magnetische Kraft oder starke und schwache Wechselwirkung. Welche Bewegungsformen hinter den verschiedenartigen Kräften stehen, fand ich in der physikalischen Literatur kaum erörtert. Doch gehen elektrische und magnetische Wirkungen von jeweils zwei gegenpoligen Formen aus, die negative und positive elektrische Ladung bzw. magnetische Nord- und Südpole genannt werden.
Gleichpolige Formen stoßen sich ab, gegenpolige ziehen sich an,
und elektrische und magnetische Kraftfelder bedingen sich gegenseitig und stehen senkrecht aufeinander. Sie müssen also zu Bewegungsformen gehören, von denen solche senkrecht zueinander stehenden Kräfte ausgehen. Die Bezeichnungen »negativ« und »positiv« sind willkürlich gewählt und ohne Bedeutung. Die negative Ladung, wie sie z.B. von Elektronen ausgeht, ist aber dem Wellenberg und dem drückenden, gebenden Prinzip zuzuordnen, während die positive, die sich im Atomkern konzentriert, dem Wellental und dem saugenden, empfangenden Prinzip entspricht.
Elektromagnetische Strahlung trägt elektrische Ladungen negativer und positiver Polarität als Hälften einer Schwingung. Diese Ladungen versetzen z.B. im Frequenzbereich der Wärmestrahlung Moleküle in Schwingung. Wechselfelder hoher und höchster Frequenzen sind in den Atomkernen und den Bausteinen von Atomen gebunden.
Aber auch ein Stab aus einem elektrisch isolierenden Material, den man an beiden Enden entgegengesetzt elektrisch auflädt, wird durch elektromagnetische Felder passender Wellenlänge in Schwingung versetzt oder sendet elektromagnetische Wellen aus, wenn er mechanisch schwingt.
Materie ist immer mehr oder weniger elektrisch polarisiert,
weil jede mechanische Spannung eine elektrische erzeugt und umgekehrt. Daher sind mit den Polaritäten mechanischer Schwingungen auch immer elektrische und magnetische Polaritäten verbunden. Außerdem sind mechanische sowie elektrische Spannungen mit Temperaturdifferenzen gekoppelt; sie können Fließvorgänge von Ladungen oder Materie bewirken, und sie nehmen Einfluss auf chemische Reaktionspotentiale. Korrosionsvorgänge können durch elektrische und mechanische Spannungen beeinflusst und ausgelöst oder auch verhindert werden.
Aus den elektrischen Polaritäten ergeben sich verschiedene chemische Polaritäten, wie die zwischen Säuren und Basen und zwischen reduzierten und oxydierten Zuständen.
Reduzierte Zustände haben Elektronenüberdruck,
also die Tendenz, Elektronen abzugeben. Dazu gehören elementarer Wasserstoff und negativ geladene Ionen, aber auch das charakteristische Ion der Basen, OH-, das eine Sauerstoffverbindung ist und seifig schmeckt. Diese reduzierten, elektronengebenden Zustände entsprechen einem Wellenberg.
Oxydierte Zustände ziehen Elektronen an.
Dazu gehören elementarer Sauerstoff und alle positiv geladenen Ionen einschließlich des charakteristischen Ions der Säuren, H+. Sie entsprechen einem Wellental. Elemente gehen, wenn sie zu Ionen werden, in die entgegengesetzte Polarität.
Säuren fördern Oxydationen,
also den Übergang in den elektropositiven Zustand, und Basen unterstützen Reduktionen, den Übergang in den elektronegativen Zustand. Die Polarität zwischen reduzierten und oxydierten, zwischen basischen und sauren Zuständen ist identisch mit der Polarität zwischen Sauerstoff und Wasserstoff bzw. zwischen den Ionen dieser Elemente. In Wasser ist sie ausgeglichen, aber für das Leben auf der Erde sind Abweichungen vom Gleichgewicht Vorbedingung. Organische Materie und die Gesteine der Erdkruste befinden sich im reduzierten, leicht basischen Zustand.
Interessant ist, dass wir »sauer« und »basisch« als Geschmacks- und Geruchsqualitäten wahrnehmen können. Sie lösen also Gefühle aus. Das sauer schmeckende H+-Ion, das Elektronen anzieht, wirkt zusammenziehend, saugend; das basisch schmeckende OH–Ion, das Elektronenüberdruck hat, dagegen quellend. Die Polaritäten und Phasen physikalischer Vorgänge
haben also auch emotionale Aspekte, die in Beziehung zu ihrem elektrischen Ladungszustand stehen.
Ganz allgemein ergibt sich, dass mechanische, elektrische, magnetische, thermische und chemische Spannungen und Polaritäten Hand in Hand gehen und dass hinter Phänomenen, die uns sehr unterschiedlich erscheinen, immer wieder dieselben Polaritäten stehen, die man sich an einem mechanischen Kreislaufprozeß klarmachen kann.
Natürlich haben alle diese Kopplungen zwischen mechanischen, elektrischen, magnetischen, thermischen und chemischen Spannungen Namen oder werden nach ihren Entdeckern benannt.
Das trägt nicht unbedingt zur Klarheit bei, weil dabei oft die Sicht für die eigentlich selbstverständlichen Zusammenhänge zwischen all diesen Phänomenen verlorengeht – und die emotionalen Aspekte werden dabei überhaupt nicht gesehen.
Die verschiedensten Phänomene können also denselben Phasen
von Kreislaufprozessen zugeordnet werden. Es werden also Dinge vergleichbar, an denen wir gewöhnlich nichts Vergleichbares finden können. Das öffnet den Zugang zu einem analogen Ordnungssystem, das quer durch die uns geläufigen Ordnungen der Phänomene geht. Dieses analoge Ordnungssystem ist die Grundlage der in alten Kulturen praktizierten Bestimmung von Orts- und Zeitqualitäten, die Grundlage der Astrologie und von Vorhersage ganz allgemein.
Dabei wird mit Hilfe von Indikatoren, wie Sternpositionen, Pflanzenwachstum, Verhalten von Tieren, Strömungsformen als »Steigbilder« oder als Formen im Kaffeesatz, die Art der Phasenkombination ermittelt, die die Zeitqualität bestimmt.
Andere Beiträge von Tattva Viveka
Sagen möchte ich jedoch noch, dass die »Götter« nicht mit ihren physikalischen Manifestationen gleichgesetzt werden dürfen, wie es die heutige Wissenschaft gern tut. Sie zeigen sich in ihnen nur, doch sie sind es nicht, so wie Krishna in der Bhagavadgita von sich sagt:
»Es stammt aus mir, es ist in mir, – doch bin ich darum nicht in ihm.
Verwirrt durch all dieses Sein in der drei Qualitäten Reich begreift die Welt es nicht, daß ich höher und unvergänglich bin. Mein göttlich Scheinbild dieser Welt, darüber kommt man schwer hinweg.« (B5)
18.07.2019
Prof. Dipl. Ing. Waltraud Wagner
www.tattva.de
© Copyright bei Tattva Viveka. Ausdruck und elektronische Weiterverbreitung zu gewerblichen Zwecken nur in Absprache mit der Redaktion. Bitte schützen Sie die Eigentumsrechte der Autoren.
B2 Bertalanffy, Ludwig von: Biophysik des Fließgleichgewichts, Vieweg, Braunschweig 1953
B3 General System Theory, George Braziller, New York 1955
B4 Perspectives on General System Theory, Braziller, New York 1974
B5 L. v. Schroeder (Übers.) Bhagavadgita, 7. Gesang, Diederichs Verl., Düsseldorf 1952
D1 Dennert, Wolfgang: Die Natur – das Wunder Gottes, S. 314, Athenäum Verl., 1957
D2 Deloria, Vine jr., We talk you listen, Macmillan Comp., New York 1970
G1 Glaser, Roland: Biophysik, G. Fischer Verl., Stuttgart 1986, UTB 1350
G2 Gipper, Helmut: Gibt es ein sprachliches Relativitätsprinzip?, S. Fischer Verl., Frankfurt 1972
H1 High Pine, Gayle, The Spirit Way, Akwesasne Notes 5, 1976
K4 Konitzky, Gustav: Nordamerikanische Indianermärchen S. 15, Eugen Diederichs Verl., Düsseldorf 1963
P1 Pelletier, Wilfred, Two Articles, Neewin Publ. Comp., Toronto, Canada, 1969 und in W2
R1 Rensing, Ludger: Biologische Rhythmen u. Regulation, S. 1, G. Fischer Verl., Stuttgart 1973
W1 Wagner, Waltraud: Zeit, das Fortschreitende oder die Ordnung, Wagner Verl., Warburg, Am Markt 3, 1980
W2 Begegnung zweier Kulturen, Wagner Verl., Warburg, Am Markt 3, 1982
W3 Tanzendes Wasser, Verl. Neue Erde, Saarbrücken 1993
Vita von Prof. Dipl. Ing. Waltraud Wagner
Geboren 1931. Studium der Chemie und Biologie. Arbeit in Instituten zu Radiochemie und Bauchemie. Dozentin an einer Ingenieur- später Fachhochschule.
Prof. Wagner ist Autorin mehrerer Bücher: u.a. Indianische Botschaft Bd. 1-3, Wagner-Verlag,
Warburg 1980-82; Maßsysteme der Tempel, Verlag Neue Erde, Saarbrücken 1988; Tanzendes Wasser, Verlag Neue Erde, Saarbrücken 1993
Alle Beiträge von Tattva Viveka auf Spirit Online

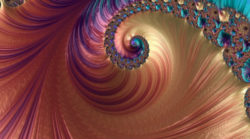




Hinterlasse jetzt einen Kommentar