
Die Macht der Bilder
Menschen, die in einer Großstadt leben werden täglich von Tausenden von Bild-Impulsen bombardiert, hinzu kommen die immer schneller werdenden Bildsequenzen in Film und Fernsehen. Ein Kriegsschauplatz eines Bilder-Hagelgewitters, wo die Schönheit dieser Welt immer mehr in den Hintergrund gedrängt wird.
Wir brauchen eine Bilder-Hygiene, damit der Mensch nicht zum Opfer von nicht mehr verarbeitbaren Eindrücken wird.
Kontemplation kennt keine Bilder.
Es ist die von Leere erfüllte Wesensschau,
der Zustand bedingungsloser Liebe.
„Lauft nicht in euer Verderben, und macht
euch kein Gottesbildnis, das irgendetwas
darstellt, keine Statue, kein Abbild eines
männlichen oder weiblichen Wesens.“
(Deuteronomium, 4,16)„Do not act corruptly by making an idol
for yourselves, in the form of any figure –
the likeness of male or female.“
(Deuteronomy 4,16)
Dieses berühmte Bilderverbot aus den 10 Geboten Gottes
am Berge Sinai wird nicht mehr ernst genommen, seitens der christlichen Kirchen schon gar nicht. Die Verführung und Manipulation durch ein Bild ist bekanntermaßen sehr groß und wirkungsmächtig, demzufolge auch ein geeignetes Instrumentarium, Menschen auf ihrem Weg zu Gott in die Irre zu führen.
Allein obige Textstellen lassen die Verschiedenartigkeit der Übersetzung im einleitenden Imperativ erkennen:
„Lauft nicht in euer Verderben!“
Die englische Version sagt:
„Handelt nicht korrupt!“
Für das Wort „Gottesbildnis“ gebraucht der Engländer den Begriff „idol“, worunter wir Götzenbild verstehen.
Und der Lateiner spricht von „sculpta“, von einem geschnitzten Bild.
Jesus Christus, Superstar eines berühmten Musicals – wir kennen seine Erscheinung, wir kennen sein Gesicht von ungezählten Bildern. Aber hat Jesus wirklich so ausgesehen? Die Evangelien verraten es nicht. Sie entstammen der Welt Israels, einer Kultur des Wortes, nicht des Bildes.
Das 20. Kapitel im 2. Buch Moses, Exodus, handelt von den 10 Geboten.
Und es beginnt mit den Worten:
„Ich bin Jahwe, dein Gott, der dich aus Ägypten geführt hat, aus dem Sklavenhaus. Du sollst neben mir keine anderen Götter haben. Du sollst dir kein Gottesbild machen und keine Darstellung von irgendetwas am Himmel droben, auf der Erde unten oder im Wasser unter der Erde…“
Ein scharfer Widerspruch zur religiösen Bilderwelt anderer Kulturen. Ein Affront gegen das Götzenbild. Der wichtigste Grund dafür, dass die Evangelien und die anderen Schriften des Neuen Testaments nichts über das Aussehen Jesu Christi berichten. Kein Wort über seine äußere Erscheinung.
Die frühe Kirche empfand das keineswegs als Mangel. Sie begnügte sich mit anderen Formen der Erinnerung: des erzählenden Memorierens seiner Worte und Taten, der kultischen Gegenwart im Abendmahl, schließlich der Schrift.
Sie kannte nur wenige Symbole und Zeichen: zum Beispiel das Namens-symbol, das Zeichen des Fisches, ein Anagramm für Jesu Name und Titel, erste einfache Symbolbilder, wie das des guten Hirten. Noch nicht das Kreuz.
Das Wort Fisch heißt auf griechisch Ichthys. Dies sind die Anfangsbuchstaben von:
| Iesus Christos Theos Yos Soter Jesus Christus, Gottes Sohn, Retter |
Als die christlichen Missionare den Glauben immer weiter in die jüdische Diaspora
(griechisch.: Zerstreuung) trugen, die hellenistisch geprägt war, änderte sich das sehr schnell. Dort trafen beide Kulturen aufeinander, die jüdische stieß auf die griechische, eine Kultur des Auges, des Schauens, des Bildes, nicht zuletzt, was die Verehrung der Götter und Heroen betrifft. Die hellenistisch geprägten religiösen Bedürfnisse erfassten nun auch christliche Kreise. Im Johannes-Evangelium (14,7-9) finden wir eine sehr wichtige Passage:
„Wenn ihr mich erkannt habt, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Schon jetzt kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Philippus sagte zu Jesus: Herr, zeig uns den Vater; das genügt uns. Jesus antwortete ihm: Schon so lange bin ich bei euch, und du hast mich nicht erkannt, Philippus. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie kannst du sagen: zeig uns den Vater?
Die Bitte des Philippus spiegelt den Wunsch vieler Neuchristen wider, dem Herrn von Angesicht zu Angesicht zu begegnen, um zu wissen, wie er ausgesehen hat.
Schon im zweiten Jahrhundert pflegten daher Christen den Brauch,
kleine amulettartige Bildnisse Jesu mit sich zu tragen. Eine, in den Augen der Bischöfe gefährliche Entwicklung: Jesus als Talisman und Glücksbringer. Noch im 4. Jahrhundert erteilte Bischof Eusebius von Caesarea sogar der Schwester des Kaisers Konstantin auf ihre Bitte um ein Jesusbild eine klare Absage:
„Da du wegen eines Bildes, das Christus darstellen sollte, schreibst und willst, dass wir dir ein solches Bild schicken: was für eins meinst du? Das wahre, das die Züge seiner göttlichen Natur trägt, oder das, welches er für uns in Knechtsgestalt annahm? Wir haben doch gelernt, dass auch dieses mit der Herrlichkeit seiner Gottheit vermischt, und alles Sterbliche vom Leben verschlungen ist. Wer aber könnte den hellen, strahlenden Glanz solcher Würde mit toten, unbeseelten Farben und Linien wiedergeben? Wie könnte jemand davon ein Bild malen?
Lang und breit begründete der Bischof seine Absage. Er beruft sich auf das Bilderverbot des Alten Testaments und auf Paulus, der im zweiten Korintherbrief 5,16 geschrieben hatte:
„Auch wenn wir früher Christus nach menschlichen Maßstäben eingeschätzt haben, jetzt schätzen wir ihn nicht mehr so ein.“
Was sind diese menschlichen Maßstäbe? Die lateinische Vulgata, die unsere deutsche Einheitsübersetzung nicht wortgetreu wiedergibt, spricht vom Fleisch.
„Et si cognovimus secundum carnem Christum sed nunc iam non novimus.“
Martin Luther übersetzt korrekt und benutzt das Wort „Fleisch“.
Ungeachtet der bischöflichen Bedenken wurde der Wunsch unter den Gläubigen immer stärker,
zu wissen, wie Jesus wohl ausgesehen haben möchte, der Wunsch, sich seine Gestalt und sein Gesicht vorstellen zu können
Motiviert schließlich durch die zahlreichen Kaiserbilder und –statuen, denen sogar religiöse Verehrung zuteil wurde, begannen christliche Künstler nach dem Ende der Verfolgungen Christus als kosmischen Herrscher darzustellen. So entstanden großartige Mosaiken, wie die von Ravenna aus dem sechsten Jahrhundert. Idealisierungen des Gesichts und der Figur Jesu. Bilder von tiefem Symbolgehalt.
Aber wie hat der Herr wirklich ausgesehen?
Niemand konnte das wissen, weil seine Jüngerinnen und Jünger es nicht überliefert hatten. Kein Maler, kein Bildhauer war in der Lage, Jesus wirklichkeitsgetreu darzustellen. Nur ein Wunder hätte helfen können.
Die Überlieferung berichtet von einer Begebenheit in Italien aus dem 6. Jahrhundert.
Volusianus, den der kranke Kaiser Tiberius auf die Suche nach dem Wundertäter Jesus geschickt hatte, traf Veronika, die als Freundin des Herrn bekannt war. Auf seine Frage hin erzählte sie:
„Als mein Herr noch durch die Welt ging, und ich seine Gegenwart nicht ständig genießen konnte, wollte ich mir sein Bild malen lassen. Da ich nun ein Tuch zu dem Maler trug, dass er mir darauf Jesu Bild male, begegnete mir der Herr. Und da ich ihm den Grund meines Weges nannte, so begehrte er von mir das Tuch. Als er es mir zurückgab, zeigte es das Bild seines Antlitzes. Es ist so wunderbar, dass Tiberius bestimmt bei seinem andächtigen Anblick gesund würde.“
Und sie fuhr mit Volusianus nach Rom, wo das Tuchbild den Kaiser tatsächlich heilte.
Die Legende hatte der im Evangelium namenlosen Frau einen Namen gegeben: Berenike, lateinisch: Veronika. Ein Name voller Symbolkraft, denn er setzt sich zusammen aus den Worten vera und ikon, übersetzt: „wahres Bild“. Dieses wahre Bild soll Kaiser Tiberius nach seiner Heilung in einen kostbaren Rahmen gefasst und in Rom aufbewahrt haben.
Im Mittelalter wurde die Legende wiederum anders erzählt:
Veronika, auch Berenike genannt, eine fromme Frau aus Jerusalem, sah Jesus sein Kreuz auf den Kalvarienberg hinauftragen. Sie nahte sich ihm, nahm ihr Kopftuch ab und trocknete damit sein von Schweiß und Blut triefendes Gesicht. Da prägte unser gütigster Erlöser diesem Tuch sein Antlitz unaus-löschlich ein. Als Zeichen seiner Liebe und als ewiges Andenken.
Diese Variante fand sehr schnell Verbreitung. Sie wurde zur sechsten Station des Kreuzwegs und seither in ungezählten Bildern festgehalten.
Legende und Bild wecken in uns ein tiefes Gefühl der Barmherzigkeit und des Mitleidens. Im Schmerzantlitz Christi ist die Passion aller Menschen präsent. Das Haupt voll Blut und Wunden wird zum Gegenstand besonderer Anbetung.
Selbst im hinduistisch geprägten Indien haben wir ein sehr ähnliches Beispiel in Chennai
(ehemals Madras), der Hauptstadt des Staates Tamil Nadu.
Oberhalb der Stadt gibt es einen nach dem heiligen Thomas benannten Hügel, wo in einer kleinen Anbetungskapelle das blutende Herz Christi dargestellt ist.
Die Inder haben den Apostel Thomas zum Heiligen ihres Landes offiziell erklärt, obwohl sein Aufenthalt auf indischem Boden eher legendenhaft zu sein scheint. Die Kathedrale von Madras ist dem heiligen Thomas geweiht, und die größte Straße der Stadt heißt: San Thomé High Road.
Die Legenden von den mystischen Tuchbildern führten zu einem neuen, weltberühmten Bildtypus, der Ikone. Ihr Name kommt vom griechischen Wort eikon, das Bild.
Ikonen entstehen in den Klöstern, die Maler sind Mönche.
Ihre Kunst wurde allerdings von einem großen theologischen Disput begleitet. Er galt der Frage, ob Jesus tatsächlich von Gestalt und Antlitz schön gewesen sei oder nicht. Ein Streit, über den man nicht so schnell lächeln sollte. Denn es ging dabei um den Gegensatz des hellenistischen Schönheitsideals und dem der jungen Christenheit.
Viele Theologen der Kirche waren von tiefer Aversion geprägt gegen einen Schönheitskult, der dem Äußeren des Menschen galt. So zitiert Origines im Jahre 250 folgende Behauptung des Christenhassers Celsus:
Christus hätte nicht als schön gegolten, weswegen er nicht Gott sein könne.
Celsus sagt:
„Da ein göttlicher Geist im Körper Jesu wohnte, hätte er durchaus von den übrigen verschieden sein müssen, entweder nach Größe oder Schönheit, nach Kraft oder Stimme, nach Auftreten oder Gabe der Überredung. Denn es ist unmöglich, dass ein Körper, dem etwas Göttliches mehr als den anderen eigen war, sich gar nicht von einem anderen unterschieden hätte. Jesus aber unterschied sich, wie sie sagen, gar nicht von einem anderen Körper, sondern war klein, missgestaltet und unedel.“
Auch die Mehrheit der Gläubigen war überzeugt, die göttliche Natur Christi habe sich in physischer Schönheit manifestiert. Diese Überzeugung prägte schließlich das Christusbild der späteren Jahrhunderte. Allerdings in einer neuen Weise.
Wie schon Augustinus gesagt hatte, ging es nicht um äußere Schönheit, sondern um eine spirituelle. Nur der Gläubige könne sie sehen. Dem Ungläubigen sei sie verborgen, so dass er Jesus für unansehnlich, ja für hässlich hätte halten können.
Mönche waren es zuerst, die diese übernatürliche Schönheit in ihren Ikonen einzufangen versuchten. Sie sahen in ihrer Kunst Gottesdienst. Wochenlang bereiteten sie sich mit Fasten und Beten auf ihr Werk vor und befolgten während der Arbeit strenge ästhetische Regeln, wie sie in den Tuchbildern vorgegeben erschienen.
Ihre Aufmerksamkeit galt nicht dem Äußeren, dem bloßen Abbild, sondern dem inneren Wesen des Herrn,
einem Prozess der abstrahierenden visionären Darstellung. Was einst für das Kaiserporträt galt, gilt jetzt für die Christusbilder: Sie werden erstellt mit Bildformeln, die nicht der privaten Person gelten, sondern der Autorität. Das geschieht durch Kleidung, Insignien, rituelle Gesten.
Auch die Physiognomie folgt dieser repräsentativen Stilisierung. Ernste und edle Züge, eine majestätische Miene, der Bart als Würdezeichen. Höchste Beachtung wird den Augen zuteil. Sie sind abnorm geweitet und vermitteln starr wirkende Unbeweglichkeit absoluter Macht und drücken zugleich die Tiefe des Innenlebens aus. Alles sammelt sich im Blick. Es ist der Blick dieser Augen, der bei der Betrachtung der Ikonen im Gedächtnis bleibt. Das Gold der Aureole und des Hintergrundes entrückt das Antlitz ganz und gar der irdischen Sphäre und macht es zu einem Gegenstand der Kontemplation und der Andacht.
Mit der Verbreitung der Ikonen war der Streit um das Bild Jesu nicht beendet. Im Gegenteil, er flammte noch einmal gewaltig auf, als der Islam die Bühne der Weltgeschichte betrat.
Mohammed hatte das biblische Bilderverbot zusammen mit dem Monotheismus
in radikaler Form übernommen.
Er gestattete nur ornamentalen Schmuck in den Moscheen, nicht die Darstellung Allahs oder die seiner Geschöpfe. Diese Bilderfeindlichkeit griff auch auf die zeitgenössische christliche Theologie über.
Sie erreichte im 8. Jahrhundert einen Höhepunkt.
Kaiser Leo III. von Byzanz trat für das Verbot von religiösen Bildern ein und ließ 727 demonstrativ eine berühmte Christusdarstellung am Chalke-Tor seines Palastes zerstören. Als seine Soldaten ausrückten, um ihr ikonoklastisches Werk zu tun, wurden sie von der Menge tätlich angegriffen, vorwiegend von gläubigen Frauen.
Die Strafe für die frommen Übeltäter war hart: Verhaftung, Auspeitschung, Verbannung. Der Kaiser wollte ein Exempel statuieren.
Er ließ alle Christus-bilder durch Kreuze ersetzen.
Aber schon ein halbes Jahrhundert später war der bilderstürmische Spuk vorbei.
Kaiserin Irene, die einzige Frau der Geschichte, die je einem Konzil präsidierte, verhalf 784 in Nizäa den Bilderfreunden zum Sieg. Wir beschließen in aller Sorgfalt und Einmütigkeit:
„So wie der Typos des kostbaren und lebensspendenden Kreuzes sind auch die verehrungswürdigen und heiligen Bilder, ob aus Farben, Mosaik-steinen oder anderem geeigneten Material, in den heiligen Kirchen Gottes anzubringen, auf den heiligen Geräten und Gewändern, auf Wänden und Tafeln, an Häusern und Wagen, und zwar sowohl das Bild unseres göttlichen Herrn und Erlösers Jesus Christus, wie unserer jungfräulichen Herrin, der Gottesgebärerin, der ehrwürdigen Engel und aller Heiligen und Gerechten.“
Aus tiefstem Grund für das Recht auf das Jesusbild sah das Konzil die Menschwerdung Christi an. Wenn Gott Mensch geworden war, durfte man ihn auch darstellen. Seine Vergegenwärtigung im Bild sollte die Andacht der Gläubigen vertiefen, ihre Frömmigkeit fördern. Gleichwohl hörte der Streit um Gebrauch und Missbrauch der Bilder in der Kirche nie ganz auf. Er schlug im Laufe der Geschichte immer wieder hohe Flammen und rief Bilderstürmer auf den Plan
Wer sich in die Schule eines spirituellen Meisters begibt,
muss wissen, dass er auf seinem Weg in den tiefen, innersten Wesenskern nach und nach die Welt der Bilder verlassen muss. Der Zen-Meister fordert: „Wenn du Buddha triffst, töte ihn. Wenn du Christus triffst, töte ihn. Wenn du deinen Eltern begegnest, töte sie.“
| Jegliches Bild auf dem Weg in die Leere, dem Ort des Lebens in Fülle, stellt ein Hindernis dar. Und es kann Jahrzehnte dauern, bis man in diesen Bereich der ewigen Heimat zurückgekehrt ist. Es gibt nicht sehr viele Meister, die einen Suchenden auf dem nicht gerade bequemen Gipfelpfad authentisch begleiten können. |
Mit Dom Bede Griffiths (1906 – 1993), dem weisen Benediktinermönch des Sat-Chit-Ananda-Ashrams in Süd-Indien hatte ich anlässlich unserer Arbeit an seinem großen Lebenswerk „UNIVERSAL WISDOM“ (deutsche Ausgabe: UNTEILBARER GEIST) im April 1991 in Shantivanam (Wald des Friedens) lange Gespräche über die Problematik der Bilder- und Vorstellungswelt.
Im Laufe dieser unvergesslichen, tagelangen Gespräche hatte er sein Vorwort zu obigem Buch verfasst, wovon das handschriftliche Manuskript im Original in meinem Besitz ist.
Bede Griffiths schreibt – und daran wird die etablierte römisch-katholische Kirche heute großen Anstoß nehmen:
„Jesus musste eine letzte Prüfung bestehen. Er war von seinem eigenen Volk abgelehnt, von der römischen Regierung verurteilt, von seinen Schülern verlassen worden, aber noch musste er ein letztes Opfer bringen.
Er musste auch noch sein Bild von Gott verlieren. Als er sterbend am Kreuz hing, rief er aus: Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist die letzte Prüfung für jede spirituelle Persönlichkeit: ihr Bild und ihre Vorstellung von Gott aufzugeben und die Wirklichkeit ins Auge zu fassen, die hinter allen Bildern und Vorstellungen liegt. Erst dann konnte Jesus sagen: Es ist vollbracht!
In jeder Religion gibt es Rituale und Lehren, durch die sich der Geist selbst mitteilt, doch haben wir stets über alle Rituale und Lehren hinaus-zugehen, um zu der Realität, die sie repräsentieren, zu gelangen. Wir kommen nicht ohne Rituale und Lehren aus. Doch wenn wir auf diesem Niveau bleiben, werden wir zu Götzenanbetern, die die Wahrheit nicht erkennen. Die Liebe ist unsichtbar, aber die mächtigste Kraft der Natur des Menschen…“
Der wichtigste Kernsatz des Mystikers und Weisen Bede Griffiths lautet:
„Kontemplation ist das Erwachen zur göttlichen Gegenwart jedes Menschen und im ganzen Universum. Kontemplation ist Erkenntnis im Zustand der Liebe.“
(Kreuth am Tegernsee, 22. September 1992)
Bede Griffiths trug keinerlei äußere Zeichen mit sich, kein christliches Amulett, keinen Rosenkranz, keine Halskette mit Medaillen, keine Armbanduhr. Er war lediglich mit dem orangefarbenen Tuch des Sannyasins bekleidet.
Kruzifixe betrachtete Bede Griffiths als grauenhafte, falsch verstandene Symbole. In seinem Ashram gab es das kosmische Kreuz, aber kein Kruzifix.
Andere Beiträge von Roland Ropers
Gegenwart ist grundsätzlich projektions-frei, losgelöst von Vergangenem und/oder Zukünftigem und demzufolge in ihrer umfänglichen Wirklichkeit nicht abbildbar. Jeder Augenblick hat eine numinose Qualität, einmalig, weder wiederhol- noch reproduzierbar.
Der Weg zum innersten Wesensgrund,
zum All-Sein ist kein Hin-Weg, sondern ein Rück-Weg, ein Heimweg. Bede Griffths spricht von: Return to the Centre, von der Rückkehr zur Mitte. Das im gegenwärtigen Augenblick Ankommen nennt man nicht Konfession, sondern Religion, die Rückanbindung an unsere ursprüngliche Wesensnatur.
| Hier erfährt der Schüler des Meisters seine immerwährende geistige Wiedergeburt, nicht aber seine Reinkarnation, seine Wieder-Fleischwerdung. |
10.03.2020
Roland R. Ropers
Über Roland R. Ropers
Roland R. Ropers geb. 1945, Religionsphilosoph, spiritueller Sprachforscher,
Begründer der Etymosophie, Buchautor und Publizist, autorisierter Kontemplationslehrer, weltweite Seminar- und Vortragstätigkeit.
Es ist ein uraltes Geheimnis, dass die stille Einkehr in der Natur zum tiefgreifenden Heil-Sein führt.
>>> zum Autorenprofil
Buch Tipp:
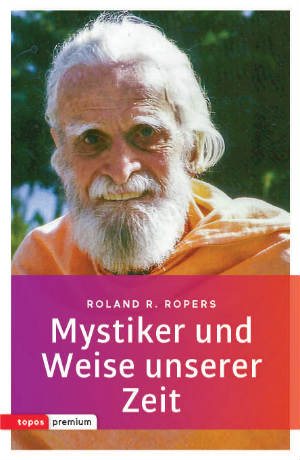
von Roland R. Ropers
Sie sind Künstler, Wissenschaftler, politische Aktivisten, Mönche die von Gott erfüllten Menschen, die auch heute etwas aufleuchten lassen von der tiefen Erfahrung des Ewigen. Und oft sind sie alles andere als fromm.
Jetzt ansehen und bestellen <<<
| Für Artikel innerhalb dieses Dienstes ist der jeweilige Autor verantwortlich. Diese Artikel stellen die Meinung dieses Autors dar und spiegeln nicht grundsätzlich die Meinung des Seitenbetreibers dar. Bei einer Verletzung von fremden Urheberrecht oder sonstiger Rechte durch den Seitenbetreiber oder eines Autors, ist auf die Verletzung per eMail hinzuweisen. Bei Bestehen einer Verletzung wird diese umgehend beseitigt. |





Hinterlasse jetzt einen Kommentar