
Warum ist Gott unsichtbar? –
Gottes-Schau
„Jetzt schauen wir in einen Spiegel und sehen nur rätselhafte Umrisse,
dann aber schauen wir von Angesicht zu Angesicht.“
(1 Korinther 13, 12)
Ein Bilderbuch versucht Kindern den Glauben an Gott nahezubringen, auch wenn sie Gott nicht sehen können wie die anderen Dinge in der Welt. Kinder fragen oft:
Warum ist Gott unsichtbar?
Könnte ich ihn sehen, so wie die Sterne, die anderen Menschen, die Welt, – es wäre alles so viel einfacher. Kein Streit mehr um den rechten Glauben, keine bange Frage, was, wenn es keinen Gott gibt? Doch wenn ich den Wunsch äußere, an Gott nicht nur zu glauben, sondern ihn auch zu sehen, werde ich schnell in die Rolle des ungläubigen Thomas gedrängt und bekomme das Jesus-Wort im Johannes-Evangelium 20, 29 vorgehalten:
„Selig sind, die nicht sehen und doch glauben!“
Ein Gott, der sich sehen ließe, wenigstens einen Augenblick lang, wie oft habe ich mir das als Jugendlicher gewünscht! Das wäre das Ende aller religiösen Zweifel: Dann hätte ich Gewissheit, ob es Gott gibt oder nicht. Aber die Antwort des Religionslehrers wie des Pfarrers war damals immer gleich: Gott kann man nicht sehen. Gott befindet sich jenseits unserer Vorstellungskraft, außerhalb der Welt. Und auf genaueres Nachfragen erfuhr ich: Gott ist nicht irgendein Ding in der Welt, das man suchen und dann finden könnte. Er ist der Schöpfer der Welt. Könnten wir Gott sehen, so wäre er nicht Gott der Schöpfer. Die Unsichtbarkeit Gottes ist ein Beweis dafür, dass es Gott überhaupt gibt.
Wenn Gott alles hervorgebracht hat, muss er unsichtbar sein.
Wäre er sichtbar, so wäre er selbst nur ein Teil dessen, was er erschaffen hat, und er könnte nicht der Schöpfer aller Dinge sein.
So wie eine Holzpuppe aus einer anderen Substanz ist als die Hand des Schnitzers, und niemals begreifen kann, wer der Schnitzer ist, der sie hervor-gebracht hat, weil sie selbst leblos ist, so übersteigt das Leben und die Existenz Gottes unsere Wahrnehmungs- und Vorstellungskraft.
Obwohl das alles einleuchtet, und obwohl das auch schon die Menschen in der Antike wussten, war die Sehnsucht vieler Menschen nicht zu stillen, Gott einmal zu sehen. Der Dichter des 42. Psalms muss geradezu krank vor Sehnsucht nach Gott gewesen sein:
„Wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so schreit meine Seele, Gott, nach dir. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann darf ich kommen und Gottes Antlitz schauen?“
Doch nicht allein im jüdisch-christlichen Kulturkreis ist diese Sehnsucht wach. In einem altperuanischen Gebet, gerichtet an den Himmelsgott heißt es:
„Wo bist Du?
Oh mögest Du Dich nicht vor Deinem Sohn verbergen!
Mag Er unten, mag Er oben sein, oder vielleicht draußen im All. (…)
Schöpfer der Welt, Schöpfer des Menschen, größter unter meinen Vorfahren!
Vor Dir erlischt das Licht meiner Augen, denn um Dich zu sehen,
Dich zu erkennen, von Dir zu lernen, Dich zu verstehen,
muss ich von Dir gesehen werden, und Du wirst mich erkennen. (…)
Oh! Höre auf mich, lausche mir! Lass es nicht geschehen,
dass ich müde werde und sterbe.“
Mag einem die Intensität, mit der in beiden Texten nach Gott gefragt wird, vielleicht übertrieben vorkommen, die Sehnsucht ist damals wie heute dieselbe: Gott möge sich zeigen, damit wir endlich wissen, über was wir reden, wenn wir von Gott sprechen. Wenn Gott sich nicht sehen lässt, dann ist alles Reden über ihn wie wenn ein Blinder von der Farbe redet.
Die Mystiker der Vergangenheit berichteten von der Gottesschau, von Ekstasen und Verzückungen, in denen sich ihnen das Unbegreifliche auf sichtbare Weise offenbarte.
Dem US-amerikanischen Psychiater und Theologen Walter Pahnke (1931 – 1971) wurde in den sechziger Jahren des 20. Jahrhunderts zu Forschungs-zwecken eine Dosis Psilocybin verabreicht, eine LSD-ähnliche Rauschdroge, die ungewöhnliche Bewusstseinszustände auslöst. Er gab damals zu Protokoll:
„Den Höhepunkt der Bilder und des Erlebens bildeten das Schauen und Erfahren der Herrlichkeit Gottes, und die göttliche Allmacht und Majestät wurden sichtbar im Blick auf die ganze Welt, im Vergleich: ganz ähnlich den Bildern der Erde, die die Astronauten später aufnahmen. Dann hörte ich eine Stimme unendlich gütig und trostreich: ‘Der Wolken, Luft und Winden / Gibt Wege, Lauf und Bahn, / Der wird auch Wege finden, / Da dein Fuß gehen kann.’ Dann schloss sich ein Vorhang oder Mantel in tiefem, herrlichem Blau, mit kostbaren Perlen geschmückt, vor dem göttlichen Lichtglanz langsam, und ich fand mich ganz klein in einer Ecke kniend, betend, ich küsste den ‘Saum des Gewandes’ und stimmte ein in das ‘Halleluja unter Tränen’.”
Der Gottesdienst vom Karfreitag 1962 war für zehn Theologiestudenten der Andover Newton Theological School ein besonderes Ereignis. An die Predigt von Pfarrer Howard Thurman erinnerten sie sich danach zwar kaum, dafür an einen Ozean von Farben, Stimmen aus dem Jenseits und das Gefühl, mit der Welt zu verschmelzen. Die Studenten waren high.
Anfang der 1960-er Jahre wandten sich mutige Wissenschaftler der Erforschung bewusstseinsverändernder Substanzen zu.
Es war die Zeit, als zu einer Vorlesung über Mystik die praktische Übung gehörte, halluzinogene Pilze zu schlucken, und eine Doktorarbeit darin bestehen konnte, Studenten unter Drogen zu setzen und ihr Verhalten zu beobachten. Genau das tat Walter Pahnke. Der junge Arzt und Theologe von der Harvard University wollte herausfinden, ob psychedelische Drogen mystische Gefühle erzeugen können, wie sie sonst nur wenige Leute zum Beispiel in religiöser Trance erlebten. Das hatten die Benutzer von LSD, Psilocybin oder Mescalin immer wieder behauptet.
Pahnke wandte sich an den Psychologen Timothy Leary (1920 – 1996), der in Harvard damals Drogenexperimente durchführte und später zu einer Leitfigur der Gegenkultur der 1960-erJahre wurde. Er schlug ihm ein Experiment vor: Versuchspersonen nehmen an einem Gottesdienst teil; die Hälfte bekommt eine bewusstseinserweiternde Droge. Danach füllen alle Teilnehmer Fragebogen aus und werden interviewt.
Leary erklärte Pahnke, dass eine psychedelische Drogenerfahrung etwas sehr Privates sei und dass man mehrere Trips erlebt haben müsse, bevor man überhaupt daran denken könne, ein solches Experiment zu planen. Doch damit wollte Pahnke bis zur Annahme seiner Doktorarbeit warten. Niemand sollte ihm Voreingenommenheit vorwerfen können. Wenn das Experiment eine Chance hatte, dann nur, wenn er noch keine Drogen genommen hatte.
Nachdem Pahnke und Leary das Verfahren festgelegt hatten, konnte das Experiment stattfinden.
Am Karfreitagmorgen, zwei Stunden vor dem Gottes-dienst, trafen sich die zwanzig Theologiestudenten. Sie wurden ermuntert, „während des Experiments nicht zu versuchen, die Wirkung der Droge zu bekämpfen, selbst wenn die Erfahrung sehr ungewöhnlich oder erschreckend sein sollte.“
In Vierergruppen warteten sie in getrennten Räumen auf die Kapseln mit dem Psilocybin, dem magischen Pilz in Pulverform, den auch Naturvölker bei Ritualen benutzen. Jede Gruppe hatte zwei Begleiter. Am Abend zuvor hatte eine am Experiment nicht beteiligte Person die Kapseln abgepackt, für jede Gruppe zwei mit der Droge und zwei Placebos. Pahnke wollte sein Experiment nach den strikten Regeln eines Medikamentenversuchs doppelblind durch-führen: Damit die Daten unvoreingenommen ausgewertet werden konnten, durften weder die Probanden noch die Versuchsleiter wissen, wer wirklich den magischen Pilz bekommen hatte.
Die fünf Gruppen wurden zum Gottesdienst in die kleine Kellerkapelle geführt, wo Pfarrer Thurmans Stimme aus dem Lautsprecher klang. Er hielt seine offizielle Karfreitagspredigt in der Kapelle ein Stockwerk höher. Zehn der zwanzig Versuchspersonen saßen aufmerksam in der Bank. Von den anderen zehn wanderten einige murmelnd durch die Kapelle, einer lag auf dem Boden, einer quer auf einer Bank, einer saß an der Orgel und spielte schräge Akkorde. Auch fünf der zehn Begleiter verhielten sich sonderbar. Leary hatte gegen den Willen von Pahnke durchgesetzt, dass auch sie die Droge bekamen. „Wir sitzen alle im gleichen Boot. Geteilte Unwissenheit. Geteilte Hoffnung. Geteiltes Risiko“, lautete seine Begründung.
Der Gottesdienst dauerte zweieinhalb Stunden.
Danach wurden die Studenten zum ersten Mal interviewt. In den Tagen nach dem Experiment und noch einmal sechs Monate danach wurden die Versuchsteilnehmer nach ihren Erlebnissen befragt. Pahnke wollte mit seinem Fragebogen den Grad des mystischen Erlebens messen. Er bestand aus Fragen zu neun Bereichen, darunter das Gefühl, eins mit sich selbst zu sein, der Eindruck der Transzendenz von Raum und Zeit, auch zu Stimmung, Unbeschreiblichkeit und Vergänglichkeit. Die Resultate waren klar: Acht der zehn Studenten, die den magischen Pilz eingenommen hatten, erlebten mindestens sieben der typisch mystischen Eindrücke und Empfindungen. In der drogenfreien Gruppe erreichte niemand einen vergleichbaren Wert. Sie lag in jeder Kategorie weit hinter der Experimentalgruppe zurück.
Auch in den Interviews zeigte sich der Unterschied. Die Studenten auf Psilocybin gaben an, der Trip habe auch in ihrem Alltag positive Wirkung gehabt: Sie hätten bewusster gelebt, sich mehr Gedanken über ihre Lebensphilosophie gemacht, sich sozial stärker engagiert. Pahnke glaubte, die positiven Folgen seien darauf zurückzuführen, dass der Gottesdienst einen vertrauten Rahmen bot, die Drogenerfahrung einzuordnen.
Das Schlucken von 30 Milligramm des weißen Pulvers führte einen Bewusstseinszustand herbei, der sich nicht von dem unterschied, was Hindus, Buddhisten oder Christen nach Selbstgeisselung, Einsiedlertum und jahrelangen Meditationsübungen erlebten.
Eine kühne Erkenntnis.
„Einigen Theologen mag die Vorstellung ironisch oder profan erscheinen“, schrieb Pahnke, „dass es möglich ist, mit Hilfe von Drogen an einem freien Samstagnachmittag eine mystische Erfahrung zu haben.“ Er war sich bewusst, dass psychedelische Drogen in der Kirche ein Reizthema waren. Das Experiment warf nicht nur die Frage auf, ob mystische Erfahrungen allein auf neurologischen Vorgängen basierten, ob der göttliche Funke in Tat und Wahrheit irdische Hirnchemie war. Es stellte auch den Grundsatz in Frage, dass man sich eine mystische Erfahrung mit Askese verdienen muss.
Pahnke glaubte trotzdem daran, dass die Erforschung dieser neuen Bewusstseinszustände eine große Zukunft hatte. Er träumte von einem Institut mit Psychologen, Psychiatern, Theologen, die den Mystizismus experimentell erforschten. Doch es kam anders: Seine Doktorarbeit wurde zwar angenommen, doch für weitere Experimente erhielt er kein Geld mehr. Psychedelische Drogen wurden verboten. Die Gesundheitsbehörden hielten sie für gefährlich. Leary wurde gefeuert. Pahnke kam 1971 bei einem Tauchunfall ums Leben.
25 Jahre nach dem Experiment suchte der Psychologe Rick Doblin (1953 -) die Versuchsteilnehmer. In vierjähriger Detektivarbeit gelang es ihm, 19 der 20 Männer ausfindig zu machen. 16 ließen sich interviewen und füllten noch einmal denselben Fragebogen aus. Das Resultat war erstaunlich konsistent. Die Männer der Experimentalgruppe und der Kontrollgruppe gaben ähnliche Antworten wie ein Vierteljahrhundert zuvor. Die Versuchspersonen aus der Experimentalgruppe bezeichneten den Karfreitagsgottesdienst von 1962 als einen der Höhepunkte ihres spirituellen Lebens. Alle gaben an, das Experiment habe sie positiv beeinflusst. Einige führten ihre spätere soziale Einstellung darauf zurück, andere ihren positiven Umgang mit der Angst vor dem Tod.
War das solch ein Blick hinter den Hügel gewesen, ein Moment, wo der Schleier gehoben wurde, hinter dem sich Gott verbirgt?
Und wenn, auf welche Weise ist diese Gottesschau zustande gekommen?
Solche Drogenversuche sind ja nicht ganz ungefährlich. Auch bei bester ärztlicher Betreuung nicht.
Gleich fünfmal wird im Neuen Testament ausdrücklich erwähnt, niemand habe Gott je gesehen. Das deckt sich ja mit der Logik, nach der, wenn es einen Gott gäbe, dieser auch unsichtbar sein müsste. Und trotzdem stehen in demselben ersten Johannesbrief, in dem der Satz steht: „Niemand hat Gott je gesehen“, auch die Worte: „Das da von Anfang war, was wir gehört haben, was wir gesehen haben mit unseren Augen, das verkündigen wir euch: das WORT des LEBENS.“
Gott ist zwar unsichtbar. Aber er wurde für die Menschen in der Person Jesu sichtbar und begreifbar. Also doch eine sinnliche Gotteserfahrung! Was wir gehört und gesehen haben. Nicht: was uns im gedanklichen Nachsinnen über Gott und die Welt eingefallen ist, sondern was wir wahrgenommen haben mit Augen und Ohren.
Unsere Augen sind meist für Gott, die kosmische Ur-Wirklichkeit, blind. Doch es besteht die Möglichkeit, dass auch ein Blinder wieder „sehend“ wird, nicht in dem Sinne, dass seine Augen wieder für Lichtreize empfänglich werden, sondern so, dass in ihm selbst ein Abbild jener Wirklichkeit aufleuchtet, die er nicht mehr mit den Augen wahrnehmen kann.
Der Franzose Jacques Lusseyran (1924 – 1971) erlitt im Jahre 1932 mit acht Jahren einen Unfall, bei dem er beide Augen verlor. Doch er überwand seine Blindheit und lernte auf neue Weise sehen. Mit einer Sicherheit, die fast an Hellseherei grenzt, erkannte er den Charakter eines Menschen an seiner Stimme und den Farben, die er vor seinen inneren Augen sah. Eine Eigenschaft, die für ihn überlebenswichtig wurde, als er sich dem französischen Widerstand gegen die Nazis anschloss und es darauf ankam, unter den Mitgliedern der Widerstandsbewegung diejenigen zu erkennen, die versteckt für die Nazis arbeiteten.
Lusseyran wurde später von den Nazis verhaftet und ins Konzentrationslager Buchenwald deportiert.
Er gehörte zu den wenigen, die dort überlebten. Nach dem Krieg wurde er Universitätsprofessor für französische Literatur in den USA. Er selbst beschreibt die Überwindung seiner Blindheit in dem Buch „Das wiedergefundene Licht“ (dtv München – 256 Seiten) mit den Worten: „Meine Blindheit war für mich eine große Überraschung, glich sie doch in keiner Weise den Vorstellungen, welche die Menschen um mich herum von ihr zu haben schienen. Sie sagten mir, Blindsein bedeute Nichtsehen. Aber wie konnte ich ihnen Glauben schenken, da ich doch sah? Nicht sofort, das gebe ich zu. Eines Tages jedoch merkte ich, dass ich ganz einfach falsch sah, dass ich einen Fehler machte. Anstatt mich hartnäckig an die Bewegung des Auges, das nach außen blickte, zu klammern, schaute ich nunmehr von innen auf mein Inneres. Unversehens verdichtete sich die Substanz des Universums wieder, nahm aufs Neue Gestalt an und belebte sich wieder. Ich sah, wie von einer Stelle, die ich nicht kannte, eine Ausstrahlung ausging, oder genauer: ein Licht. Ein Blinder findet wieder den Zugang zum Licht. Ein für Außenstehende zunächst unbegreiflicher Vorgang.
Das Licht war da, das stand fest. Ich fühlte eine unsagbare Erleichterung, eine solche Freude, dass ich darüber lachen musste. Ohne Augen war das Licht weit beständiger, als es mit ihnen gewesen war. Jene Unterschiede zwischen hellen, weniger hellen oder unbeleuchteten Gegenständen, an die ich mich damals noch genau erinnern konnte, gab es nicht mehr. Ich sah eine Welt, die ganz in Licht getaucht war, die durch das Licht und vom Licht her lebte. Auch die Farben – alle Farben des Prismas – bestanden weiterhin. Das Licht breitete seine Farben auf Dinge und Wesen. Mein Vater, meine Mutter, die Leute, denen ich auf der Straße begegnete oder die ich anstieß, sie alle waren in einer Weise farbig gegenwärtig, wie ich es niemals vor meiner Erblindung gesehen habe.“
Die Erfahrungen Lusseyrans lassen noch einen weiteren Schluss zu, der vor allem für Christen interessant ist: Er hat als Blinder die Welt des Lichts und der Farben neu entdeckt. Diese Erfahrung haben wir mit ihm gemeinsam: Für Gott sind auch unsere Augen blind. Doch so, wie ein Blinder die Welt neu sehen kann, könnte auch für uns die Möglichkeit bestehen, Gott neu wahrzunehmen, obwohl er unsichtbar ist. Wohl nicht mit unseren Augen, aber doch in dem Licht, das durch sie und auch ohne sie von ihm zu uns durchdringt, uns erhellt und uns im wahrsten Sinne des Wortes zu erleuchten vermag.
Für Lusseyran war das übrigens ein und dasselbe, Gott, das Licht und das Leben.
Er sah es, und er wurde von dem Licht geführt.
Unser Wissen über Gott können wir nur über den Weg der sinnlichen Erfahrung gewinnen. Einen anderen Weg gibt es nicht. In Abwandlung eines berühmten Ausspruches von Ludwig Wittgenstein (1889 – 1951) könnte man sagen: Was wir nicht wahrnehmen können, darüber können wir auch nicht reden. Wenn wir über Gott reden, müssen wir uns in irgendeiner Weise eine Vorstellung von ihm machen, eine Vorstellung aufgrund von Erfahrung. Wir haben es in der Vergangenheit verlernt, tiefer zu sehen, und vielleicht sind unsere Augen dabei auch ein Hindernis. Wir nehmen die Welt nur noch als Welt wahr, wir nehmen nicht wahr, dass sie die Schöpfung eines anderen ist.
Wir sehen also, mit unseren Augen vermögen wir Gott genauso wenig zu erkennen wie ein Blinder in der Lage ist, die Welt zu sehen.
Und doch, ähnlich wie der blinde Jacques Lusseyran vor seinen inneren Augen das Licht und die Welt neu wahrnehmen konnte, so kannten auch die Menschen früherer Zeiten verschiedene Wege, um Gott wahrzunehmen. Gott nicht von Angesicht zu Angesicht sehen zu können, bedeutete noch lange nicht, ihn überhaupt nicht wahrzunehmen. Das wusste auch schon Paulus: „Jetzt schauen wir in einen Spiegel und sehen nur rätselhafte Umrisse, dann aber schauen wir von Angesicht zu Angesicht.“
Wir heute sehen noch nicht einmal ein dunkles Bild von ihm. Wir sehen nur die Welt allein als Welt. Die Welt als Spiegel zu erleben, in dem die Spuren des verborgenen Gottes sichtbar werden, haben wir verlernt. Aber solche Spuren Gottes kann ich überall wahrnehmen: Im Farbenreichtum der Natur erlebe ich die Farbigkeit und Schönheit Gottes, der die Natur geschaffen hat.
Wer Jesus sieht, so wie ihn uns die Texte des Neuen Testaments vor Augen malen, der sieht, wie Gott ist.
Es gibt Menschen, die Wahrnehmungen haben, Wahrnehmungen, in denen ihnen ein Wesen gegenübertritt, das die Grenzen ihrer Vorstellungskraft überschreitet. Aber das ist nicht das Ende des Glaubens, sondern der Anfang. Die Sehnsucht kann dem Menschen doch nicht ohne Grund ins Herz gelegt worden sein, Gott einmal von Angesicht zu Angesicht zu sehen.
26.08.2021
Roland R. Ropers
Religionsphilosoph, spiritueller Sprachforscher, Buchautor und Publizist
 Über Roland R. Ropers
Über Roland R. Ropers
Roland R. Ropers geb. 1945, Religionsphilosoph, spiritueller Sprachforscher,
Begründer der Etymosophie, Buchautor und Publizist, autorisierter Kontemplationslehrer, weltweite Seminar- und Vortragstätigkeit.
Es ist ein uraltes Geheimnis, dass die stille Einkehr in der Natur zum tiefgreifenden Heil-Sein führt.
>>> zum Autorenprofil
Buch Tipp:
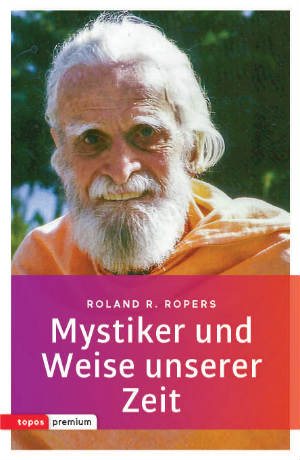
von Roland R. Ropers
Sie sind Künstler, Wissenschaftler, politische Aktivisten, Mönche die von Gott erfüllten Menschen, die auch heute etwas aufleuchten lassen von der tiefen Erfahrung des Ewigen. Und oft sind sie alles andere als fromm.
> Jetzt ansehen und bestellen <<<







Hinterlasse jetzt einen Kommentar